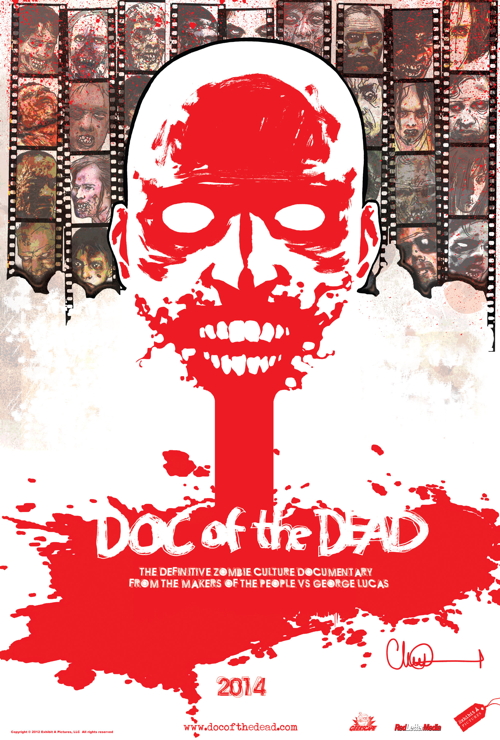Die Spur des Falken
„Ich bin ja völlig derangiert, Mr. Spade!“
US-Filmemacher John Huston adaptierte einst einen bereits zweimal verfilmten Roman Dashiell Hammetts in Drehbuchform und debütierte mit dessen Inszenierung sogleich als Regisseur: Mit dem 1941 veröffentlichten „Die Spur des Falken“ schuf er dabei nicht weniger als den Hard-Boiled-Detective-Film-Genre- und Film-noir-stilbegründenden Meilenstein der Filmgeschichte, der zahlreiche andere Autoren und Regisseure inspirierte und Nachahmer nach sich zog.
„Sie tun mir Unrecht, sagte die Schlange, als sie das Kaninchen verspeiste!“
San Francisco, USA: Als eine Frau (Mary Astor, „Vertauschtes Glück“) das Büro des Privatdetektivs Sam Spade (Humphrey Bogart, „Der versteinerte Wald“) aufsucht, ahnt dieser noch nicht, in welch tödliche Auseinandersetzungen er durch diesen schicksalhaften Besuch hineingezogen werden wird. Sie sei auf der Suche nach ihrer Schwester, sagt sie, und bittet Spade und seinen Partner Miles Archer (Jerome Cowan, „Tanz mit mir“), den ihr angeblich verdächtigen Thursby zu observieren. Dieser Job wird Archer das Leben kosten, kurz darauf ist auch Thursby tot – und Spade unter Mordverdacht. Dessen Ermittlungen konzentrieren sich nun auf die unheilige Frau, deren wahrer Name Brigid O’Shaughnessy lautet. Anscheinend geht es um eine Falken-Skulptur, hinter der aus zunächst unerfindlichen Gründen mehrere Leute her sind…
Eine Texttafel erläutert zu Beginn knapp die Hintergründe der Skulptur des Malteser Falken, anschließend gehört der Film ganz seinen Schauspielerinnen und Schauspielern respektive den von ihnen verkörperten Figuren, allen voran Sam Spade, einem arroganten Kontrollfreak und Macho, der eine Affäre mit der Frau (Gladys George, „Die wilden Zwanziger“) seines Partners pflegte und nach dessen Tod nicht zögert, die bisher gemeinsame Detektei in Windeseile umzubenennen. Er ist ein kaltschnäuziger Unsympath und Einzelgänger und als furchtloser, souveräner Privatdetektiv der Archetyp des zweifelhaften Film-noir-Protagonisten, dem erst in der weiteren Genre- und Stil-Ausentwicklung gebrochene männliche Charaktere als Alternative angeboten werden würden.
Brigid O’Shaughnessy hingegen ist die klassische Femme fatale: Durchtrieben, (nicht nur) mit den Waffen einer Frau manipulativ um ihren eigenen Vorteil kämpfend und dabei über Leichen gehend. Sie gibt sich verletzlich, hilflos und unschuldig, ist aber eigentlich ähnlich zielstrebig und tollkühn wie ihre männlichen Kollegen, eventuell gar noch skrupelloser. Sie wechselt ständig ihren Namen und hat die Geschichte mit ihrer Schwester nur erfunden. Thursby habe sich als ihr Freund aufgespielt; sie habe wissen wollen, mit wem sie es zu tun hat. Nun fühle sie sich verfolgt. Was kann man dieser Frau glauben? Die Geschichte wird komplex, um nicht zu sagen: verworren. Der offenbar homosexuelle Joel Cairo (Peter Lorre, „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“) wird ebenfalls bei Spade vorstellig und bietet ihm im Namen seines Auftraggebers 5.000 Dollar für die Beschaffung des Malteser Falken. Plötzlich bedroht er ihn mit einer Waffe, um sein Büro durchsuchen zu können, doch knockt Spade ihn aus. Beim Versuch, die Wahrheit herauszufinden und den ganzen Spuk unversehrt durchzustehen, avanciert Spade zu einem noir-typisch etwas schrägen, umso ambivalenteren Typus von Identifikationsfigur und Sympathieträger. Und seinen Chauvinismus stellt er unter Beweis, indem er sich mir nichts, dir nichts seine Klientin greift und sie küsst…
Der unfähige Möchtegern-Gangster Wilmer Cook (Elisha Cook Jr., „Tin Pan Alley“) und zwei ermittelnde Polizisten, die ebenfalls immer wieder mit Spade aneinandergeraten, komplettieren den Reigen sich gegenseitig übers Ohr hauender Figuren, mit denen Spade zuweilen gemeinsame Sache macht. Im letzten Drittel sind alle Akteure in einem Raum vereint und Dialog reiht sich an Dialog, aber Kamera und Sprach- sowie Bewegungsrhythmus sorgen für Dynamik. Besagte Kamera trägt ihren entscheidenden Anteil zur Definition des Film-noir-Stils bei, indem sie die Licht- und Schattenspiele des deutschen Expressionismus aufgreift und mit mal mehr, mal weniger allegorischen Asymmetrien arbeitet. Eine rein positive Charakterkonnotation wird man hier vergebens suchen, dafür umso mehr Habgier und Verkommenheit finden.
Damit vereint „Die Spur des Falken“ bereits einen Großteil der Film-noir-Versatzstücke, wenngleich ihm mit dem eher komödiantisch geprägten männlichen Gangster-Duo noch etwas Comichaftes anhaftet, das späteren Beiträgen zur Schwarzen Serie (wie die damaligen Noir-Filme auch zusammenfassend bezeichnet wurden, hat also nichts mit „Der Prinz von Bel-Air“ und Konsorten zu tun) abgehen sollte. Auch ist die Geschwätzigkeit dieses Films noch untypisch. Die titelgebende Skulptur erweist sich als typischer MacGuffin Hitchcock’scher Prägung (und wurde in den 1980ern zum Namen einer der besten Heavy-Metal-Bands Dänemarks). Sam Spade wird im Filmverlauf ungesunde Gefühle für O’Shaughnessy entwickeln, diese aber verleugnen und begraben, statt an ihnen zu verzweifeln und zugrunde zu gehen wie spätere von Schwarzen Witwen gefressen werdende Noir-Antihelden. Auch ohne durch die Handlung führende, im Präteritum gehaltene Off-Stimme des Protagonisten, die ein Markenzeichen manch späteren Genrebeitrag werden sollte, ist man als Zuschauer(in) mit wenigen Ausnahmen recht eng an Spades Seite und nimmt so dessen subjektive Perspektive ein.
Definitiv eine reife und wichtige Pionierleistung Hustons, die Bogart endgültig zu Filmstarruhm verhalf, wenngleich spätere, fatalistischere Beiträge in Sachen düsterer Stimmung meines Erachtens die Nase vorn haben. Hierzu sei jedoch angemerkt, dass ich mich auf die deutsche Fassung mit ihrem gegenüber dem US-Original geänderten, nunmehr jazzigen Soundtrack beziehe, die, so heißt es, eine ganz andere Atmosphäre als die ursprünglich intendierte erzeuge. Eventuell werde ich dies beizeiten überprüfen, indem ich mich mit der Originalfassung auseinandersetzen werde – doch, ach, wirken andere anzuschauende und zu besprechende Genrebeiträge gerade ähnlich verführerisch wie manch Femme fatale auf mich…