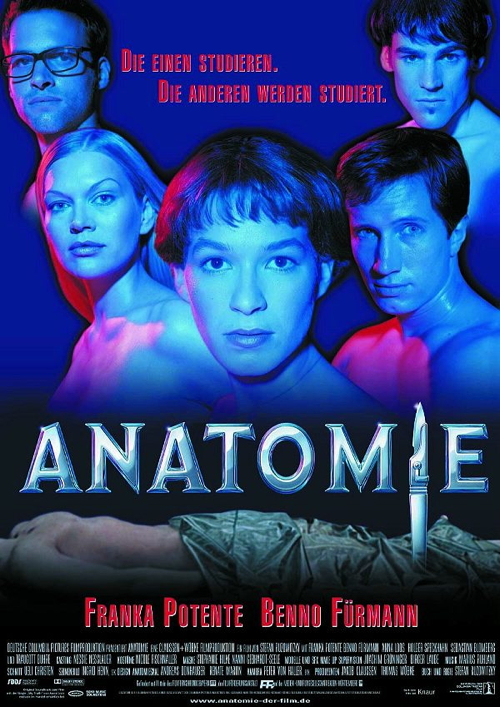Hardcover
„Alles fit for fun?“Christoph (Lukas Gregorowicz) hat seit der Uni außer seinem Kleinwagen nicht viel bewegt. Er wäre zwar gern ein bekannter Schriftsteller, doch nicht nur sein Selbstbewußtsein, auch seine bisherigen Werke bewegen sich auf äußerst niedrigem Niveau: Er schreibt klischeebeladene und hanebüchene Kriminalgeschichten für einen Groschenromanverlag. Da er davon nicht leben kann, bessert er seine Finanzen mit einem Nebenjob bei einer Autovermietung auf. Als er dabei dem Kleinkriminellen Dominik (Wotan Wilke Möhring) begegnet, der versucht, eines der Autos zu klauen, sieht Christoph seine große Chance gekommen. Er rettet Dominik vorm Gefängnis und als Gegenleistung soll ihm dieser Einblicke in das Gangsterleben verschaffen, die er in einen authentischen Roman umsetzen will. Doch der Weg zum ersten richtigen Roman mit Hardcover ist beschwerlich und Christoph erlebt bei seinen Recherchen mehr als ihm lieb ist ...
Konnte der einheimische Regisseur Christian Zübert mit seinem Regiedebüt „Lammbock“ bereits eine beachtliche Komödie dem mit gelungenen deutschen Unterhaltungskinoproduktionen nicht gerade überversorgten Publikum präsentieren, setzte er 2008 mit „Hardcover“ noch einen drauf.
„Buddy Movies“ erfreuen sich stets einer gewissen Beliebtheit, sicherlich aus gutem Grunde. Zwei eigentlich konträre Charaktere zusammenzubringen und in gegenseitige Abhängigkeit zu setzen, bietet viel Potential für reichlich Komik, aber auch für einige sensible Momente, für Plädoyers für die Freundschaft. In „Hardcover“ trifft der verhinderte Romanautor Christoph (Lukas Gregorowicz), dessen Talent leider nur für billige Groschenromane reicht und der sich mit einem Job in einer Autovermietung über Wasser hält, auf den Kleinganoven Dominik (Wotan Wilke Möhring), der chronisch pleite vom großen Geld träumt und als Hiwi für eine Unterweltkapazität fungiert. Christoph verspricht sich von der Teilhabe an Dominiks Leben die entscheidende Inspiration für seinen geplanten Kriminalroman. Er lässt ihn bei sich wohnen und begleitet ihn in seinem Alltag – bis man in Konflikt mit Boss „Chico“ gerät…
Christoph ist ein verschüchterter, unsicherer Typ mit angeknackstem Selbstvertrauen, während Dominik ein kleiner Straßenproll der Sorte „Große Klappe, nichts dahinter“ ist. Diese Konstellation ist Ausgangspunkt für viel Situationskomik und Milieu-/Wortwitz. Dass „Hardcover“ als Komödie so gut funktioniert, liegt meines Erachtens in erster Linie daran, dass beide von Gregorowicz und Möhring verkörperten Klischeetypen so detailverliebt und mit stets erkennbarem Realitätsbezug konzipiert wurden. Dabei geht es nicht darum, diesen Menschenschlag gnadenlos vorzuführen, sondern die gar nicht mal so unsympathischen, besonders im Falle Dominiks eher liebenswerten Verlierertypen hinter den Fassaden hervorzukehren und langsam zu Identifikationsfiguren für den Zuschauer zu machen. Das gelingt vorzüglich, wodurch die Distanz des Publikums zum Geschehen abnimmt und es in die Geschichte eintaucht, mitfiebert und mitleidet.
Doch das allein würde nicht ausreichen, wären nicht die schauspielerischen Leistungen auf durchgehend hohem Niveau, wobei mir Möhring zwar auf seinen Rollentyp abonniert scheint, Gregorowicz aber mit subtiler Mimik – selten in einer von ihren Übertreibungen lebenden Komödie – die Gefühlswelt des verschlossenen, verkopften Christoph überraschend authentisch zum Ausdruck bringt. Nicht selten erinnern mich Gregorowicz und Möhring an Oliver Dittrich und Wigald Boning zu deren Glanzzeiten.
Noch einmal möchte ich die Beobachtungsgabe der Drehbuchautoren loben, die den ganz normalen Wahnsinn der deutschen Gegenwart ebenso parodistisch durch den Fleischwolf dreht wie Rotlicht-Klischees bzw. insbesondere ihre filmische Umsetzung. Apropos Klischees: Ein geschickter Zug von „Hardcover“ ist es, die angesprochenen Klischees zwar einerseits voll diebischer Freude zu bedienen, in entscheidenden Momenten aber immer wieder eine Überraschung im Verhalten seiner Protagonisten parat zu haben, die nicht ganz in die stereotypen Schemata passen wollen. Das macht den Film nur umso angenehmer und bewahrt ihn immer wieder vor Plattitüden.
Fazit: Weitaus weniger krawallige Komödie als aufgrund ihrer Thematik zunächst befürchtet aus deutschen Landen, deren Humor zumindest bei mir voll zündet und die mit begnadeten Schauspielern glänzt. „Hardcover“ besinnt sich auf kurzweilige Unterhaltung auf höherem Niveau und verzichtet weitestgehend auf zuviel aufgeblasenes Brimborium drumherum. Meines Erachtens eine Steigerung gegenüber „Lammbock“ und ein Tipp für alle, die ihren Spaß an jüngeren, erfrischenden Komödien aus heimischer Produktion haben.