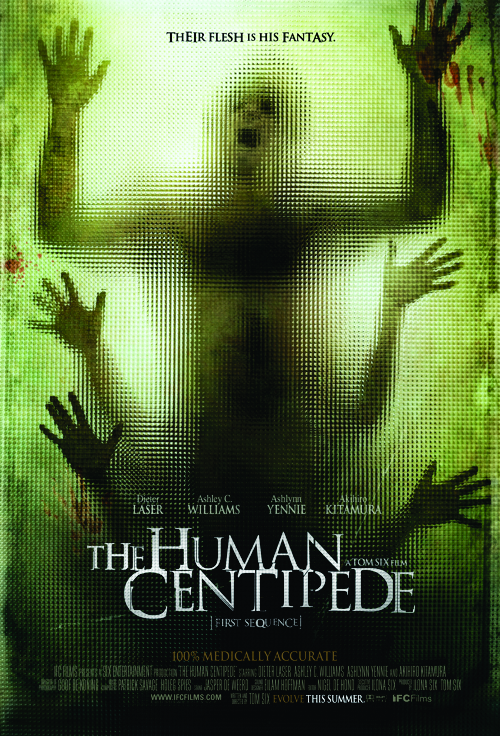The Loved Ones – Pretty In Blood
Das Spielfim-Regiedebüt des australischen Regisseurs Sean Byrne aus dem Jahre 2009 rief manch begeisterte Reaktion hervor. Thematisch widmet er sich augenscheinlich dem kassenträchtigen Teen-Horror-Bereich: Brent (Xavier Samuel, „Eclipse – Biss zum Abendrot“) ist traumatisiert, nachdem er am Steuer saß, als er einer urplötzlich auf der Straße in seiner abgelegenen Gegend auftauchenden blutigen Gestalt auswich und dadurch einen Unfall mitverursachte, der seinen Vater das Leben kostete. Einige Zeit später plant er, mit seiner liebevollen Freundin Holly (Victoria Thaine, „Die Maske 2“) auf den Schulabschlussball zu gehen. Der unscheinbaren Lola (Robin McLeavy) erteilt er daher eine Absage – ein folgenschwerer Fehler, denn diese ist psychisch etwas anders gepolt, lebt mir ihrem auf seine Art aufopferungsvollen Vater (John Brumpton, „Storm Warning“) und ihrer dementen (Stief-?)Mutter (Anne Scott-Pendlebury, „Nachbarn“), genannt „Strahleauge“, von der Außenwelt abgeschottet zusammen und bekommt in der Regel, was sie möchte. So lässt sie Daddy kurzerhand Brent entführen und an einen Stuhl fesseln, um ihren ganz persönlichen Abschlussball zu zelebrieren.An der High-School steht der Abschlussball vor der Tür, und der langhaarige Brent ist schwer gefragt. Brent aber, der noch immer unter den Folgen eines traumatischen Autounfalls leidet, hat nur Gedanken für seine Freundin Holly, weshalb er der schüchternen Lola leider einen Korb geben muss. Lola jedoch ist keine, die sich mit einer Abfuhr abfindet. Denn Lola kriegt für gewöhnlich, was Lola will...
„Carrie“ trifft auf „The Texas Chainsaw Massacre” trifft auf sog. Torture Porn trifft auf Revenge-Movie – damit lässt sich die Handlung von “The Loved Ones” groß umreißen. Der „Carrie“-Anteil ist dabei eigentlich eine Umkehrung der King’schen Ausgangssituation, denn unsere fesche Lola ist keinesfalls ein böswillig von ihrer Mitmenschen drangsaliertes, scheues Etwas, sondern eine von Haus aus narzisstische, sadistisch veranlagte Psychopathin, die das gemeinsame Abendessen ähnlich herrichtet wie Familie Sawyer in Tobe Hoopers Backwood-Knüller und fortan vor keinem Mittel und keinem Gerät zurückschreckt, um ihren Angebeteten gefügig zu machen – und das nicht zum ersten Mal, wie sich herausstellen soll. Da werden Injektionen verabreicht, mittels Bohrmaschine Lobotomieversuche unternommen und Küchenmesser zweckentfremdet. Das erinnert nicht von ungefähr an jüngst so angesagten Folter-Horror, wobei die Selbstzweckhaftigkeit nicht gar so arg ausfiel und nicht jedes Detail grafisch explizit ausgeschlachtet wird.
Die Ernsthaftigkeit, mit der die eigentlich völlig groteske Situation in bizarrem Ambiente inkl. geschmacklos-kitschig hergerichteter Behausung Lolas inszeniert wird, macht aber schnell deutlich, dass mit diesen Psychos nicht zu spaßen ist und lässt die angepeilte Wirkung der Folterszenen sich voll entfalten. Ja, „The Loved Ones“ ist hart und zynisch, lässt dabei aber immer wieder überspitzten, rabenschwarzen Humor durchblitzen, der dem Film seinen über die Gräuel hinausgehenden Unterhaltungsfaktor sichert, der ohne ihn eher fragwürdiger Natur wäre. Und keine Sorge, „The Loved Ones“ erzählt durchaus eine richtige Geschichte, die Puzzleteile zusammenfügt, offene Fragen klärt und die eine oder andere Überraschung bereithält. Einmal mehr wird durch einen Horrorfilm der lachhafte Abschlussballwahn aufs Korn und zum Anlass blutiger Exzesse genommen, die als Ventil für pubertätsbedingte psychische Zerreißproben geplagter Teenagerhirne dienen, als filmische Parabel auf den jenen Spektakeln innewohnenden Wahnsinn. Byrne präsentiert uns Außenseiter, die bereits in jungen Jahren mit ihrem Leben hadern und mit ihren Problemen fertig werden müssen, wobei die Erwachsenenwelt keine große Hilfe ist.
Sehr angenehm fallen dabei die gerade für einen Horrorfilm mit Teenager-Thematik natürlich erscheinenden Darsteller auf, allen voran beide an Brent interessierten Mädels, von denen Robin McLeavy als Lola all ihre entrückten Facetten beeindruckend beherrscht und gepresst in ihr plumpes rosa Ballkleid Mut zur Hässlich- und Grausamkeit beweist, es aber dem Zuschauer überlässt, in ihren blitzenden Augen nicht doch auch „Daddys Prinzessin“ auszumachen. Die Sympathien werden aber natürlich eindeutig Brent zuteil, der lange Zeit ohne Dialogzeilen auskommen muss und in einer Ausschließlichkeit als bemitleidenswerter Schmachthaken gezeichnet wurde, dass das Mitfiebern mit ihm obligatorisch ist. Von traurig über schmerzvoll leidend bis zu rasender Wut reicht seine Emotionspalette, die er glaubwürdig darstellt. Psycho-Dad John Brumpton wurde ebenfalls gut gecastet, passt er in seiner Unscheinbarkeit doch gut zu Lola und wirkt ebenso wie sie mit seinem wirren Blick trügerisch beinahe mitleiderregend, zumindest aber derart, dass man ihm nicht von vornherein sämtliche Grausamkeiten zutrauen würde, weshalb er das Überraschungsmoment häufig auf seiner Seite hat. Die inzestiöse Beziehung zu seiner Tochter bleibt übrigens angedeutet.
Im von Rache beherrschten Finale wird die angesichts der vorausgegangenen Ereignisse aufgestaute Vergeltungssucht des Zuschauers bedient, was einerseits befriedigt, andererseits aber nicht wirklich überrascht. Überrascht hat mich stattdessen, wie wenig die ausgiebige, für meinen Geschmack etwas zu komödiantische Nebenhandlung um Brents unbeholfen und unerfahren erscheinenden Kumpel, der mit einer heißen Metalbraut den Abschlussball besucht, sich mit ihr betrinkt, bekifft und schließlich Sex mit ihr hat, mit der eigentlichen Handlung zu tun hat und deshalb enttäuschend überflüssig wirkt. Positiv aufgefallen sind mir hingegen einige schöne, zur manchmal durchschimmernden, leisen Melancholie des Films passenden, in die Tiefe gehenden Aufnahmen der einsamen Landstraße und der sie umgebenden Natur. Da Brent und seine Freunde sympathischerweise auf Thrash Metal stehen, ertönt im Rahmen des Soundtracks manch hartes Stück, aber auch sanftere Klänge fanden ihren Weg in den Film und unterstreichen den Zynismus der sich bei Lola zuhause abspielenden Groteske, wenn Balladeskes erklingt, während Brent um sein Leben fürchtet. Ein hörenswerter Soundtrack, dessen Veröffentlichung wünschenswert wäre.
Fazit: Byrne ist ein beachtliches Debüt gelungen; ein guter Horrorfilm, der Genremoderne mit klassischen Motiven verbindet, Emotionen schürt und sich entladen lässt und handwerklich auf relativ hohem Niveau agiert. Für den ganz großen Wurf mangelt es aber noch etwas an Alleinstellungsmerkmalen, an Konsequenz und originellem Einfallsreichtum, weshalb ich Genrefreunden „The Loved Ones“ durchaus ans Herzen legen möchte, den (kleinen) Hype um ihn aber als übertrieben empfinde.