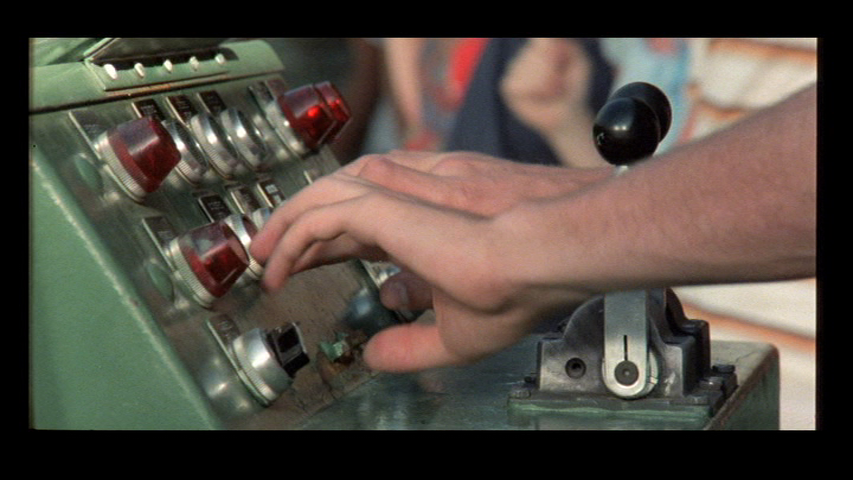- MV5BY2RhZGQ5ZDYtYWM4NC00MmIzLWI0MTQtMGNlNTQzYTA4MWQwXkEyXkFqcGdeQXVyMTQxNzMzNDI@._V1_SY1000_CR0,0,663,1000_AL_.jpg (122.07 KiB) 543 mal betrachtet
Originaltitel: Kiss Meets the Phantom of the Park
Produktionsland: USA 1978
Regie: Gordon Hessler
Darsteler: Ace Frehley, Gene Simmons, Peter Criss, Paul Stanley, Anthony Zerbe, Deborah Ryan
Seit einigen Wochen verschwende ich meine kostbare Zeit erfolglos darauf, dem Phänomen der Rockband Kiss auf den Grund zu gehen. Die für mich zentrale Frage: Wie konnte es eine derart mittelmäßige Gruppe, deren Oeuvre nahezu ausnahmslos aus generischsten Songs, die monothematisch um Pussys und Partys kreisen, zu derartigem Weltruhm bringen, der sie noch fünfzig Jahre nach Gründung die Arenen rund um den Globus mit frenetisch kreischenden Fans füllen lässt? Das kann doch nicht allein an der zugegebenermaßen innovativen Kostümierung liegen, daran, dass die vier Bandmitglieder Gene Simmons, Ace Frehley, Paul Stanley, Peter Criss sich zu nahezu mythischen Wesen überhöhten, indem sie sich mittels Massen an Schminke in Demon, Space Ace, Star Child, Cat Man verwandelten, meterhohe Plateau-Schuhe trugen, Blut und Feuer spuckten. Selbst die reibungslos laufende Kapitalismusmaschinerie, die einem bereits in den 70ern Bettwäsche, Spielzeugfiguren, Handtücher mit Kiss-Logo offeriert, kann mir nicht wirklich plausibel machen, wie es kommen konnte, dass die New Yorker Boygroup innerhalb kürzester Zeit in den ökonomischen Olymp der Popmusik gehoben wurde. Für mich klafft da nämlich ein zugleich faszinierender wie abstoßender Krater zwischen dem megalomanischen Image, das die Band um sich herum auftürmt, und dem, was die vier Herren dann an tatsächlicher musikalischer Qualität abliefern: So viele Tonnen Make-Up, solch ausufernde Bühnenshows, so viel Feinschleif bei der Ikonographie, und alles, was die Band mir zu erzählen hat, ist: I want Rock n Roll all night and party every day? Dazu dann noch die wenig sonoren Stimmchen, das dürftige Songwriting, die monotone Instrumentierung und als Sahnehäubchen Gene Simmons‘ obszönes Zungenwedeln, das ich schon immer entweder pubertär peinlich oder eklatant eklig fand, und ich stehe erneut mit gerunzelter Stirn im Plattenladen meines Vertrauens und staune darüber, was für einen breiten Output Kiss doch besitzt, und wie treu ihre Anhänger, die sogenannte Kiss Army, noch den hundertsten Aufguss ihres hedonistisch-sexistischen Liedguts aufkaufen.
Angehört habe ich mir in letzter Zeit sämtliche Kiss-Alben bis zu dem Zeitpunkt, als die an Bedeutung verlierende Band sich Mitte der 80er entscheidet, komplett aufs Make-Up zu verzichten und für weit über ein Jahrzehnt ohne ihr Trademark-Element aufzutreten. Angefangen von den zuweilen durchaus noch unterhaltsamen, eingängigen und eindimensionalen Songs der Anfangstage über das von Bob Ezrin zu Tode produzierte „Destroyer“-Album (1976) bis hin zu dem furchtbar poppigen, von Disco-Beats durchsetzten „Dynasty“ (1979), das immerhin die Hitsingle „I was made for loving you“ enthält, konnte meine Ohren nicht wirklich etwas entdecken, bei dem es länger verweilen wollte. Am positivsten herausgestochen aus der eintönigen Diskographie hat für mich tatsächlich gerade das Album, von dem sich sowohl die Fans wie auch die Band selbst im Nachhinein fulminant distanzieren: „Music from ,The Elder‘“ aus dem Jahre 1981, auf dem Kiss mit opulentem Fantasy-Storytelling aufwarten, ein Symphonieorchester bestellten, sich stellenweise gar in Progressivem Rock mit Tendenzen zu Mittelaltermarkt-Flair verlieren – ein Experiment, das leider aus kommerzieller Sicht scheiterte, denn vielleicht hätten sich Kiss ausgehend von diesem jähen Stilwandel doch noch in eine interessante, sprich, erträgliche Richtung für mich entwickeln können. Der radikale Kurswechsel auf „The Elder“ indes ist einer schwierigen Phase geschuldet, die die Band zu diesem Zeitpunkt durchmacht. Gespalten ist Kiss schon seit den späten 70ern quasi in zwei Lager, was nicht zuletzt ein schlicht unglaublicher Fernsehauftritt in der Talkshow von Tom Synder 1979 belegt: Links auf dem Sofa sitzen Gene Simmons und Paul Stanley, sichtlich bemüht, eine seriöse Interviewsituation aufrechtzuhalten, während rechts Peter Criss und vor allem der unverhohlen alkoholisierte und/oder narkotisierte Ace Frehley gackern, was das Zeug hält, zügellos herumblöden, ihren Bandkollegen ins Wort fallen, um himmelschreienden Unsinn zu verzapfen. Bereits 1978 hatte das Auseinanderbrechen des Bandgefüges nur dadurch verhindert werden können, dass jedem der vier Gründungsmitglieder die Möglichkeit gegeben wurde, ein Soloalbum aufzunehmen, (von denen wiederum ich einzig und allein dasjenige von Ace Frehley halbwegs hörbar finde.) Verhindert werden kann trotzdem nicht, dass Anfang der 80er sowohl Schlagzeuger Criss wie Lead-Gitarrist Frehley, je nach Darstellung, das Handtuch werfen bzw. wegen ihres Drogenkonsums und damit verbundener Unzuverlässigkeit und Unzurechnungsfähigkeit vom verbleibenden Duo Simmons/Stanley aussortiert werden.
Zu einem Zeitpunkt jedenfalls, als schon absehbar scheint, dass Kiss allmählich von der Baumkrone des Erfolgs auf immer bodennähere Äste abgleiten, hat die Band respektive ihr Management folgende glorreiche Idee: Weshalb nicht einen Kiss-Film produzieren, ein Leinwandvergnügen für Groß und Klein, in dem die vier Musiker ausgestattet mit Superkräften für das Gute ins Feld ziehen, und, sagen wir, einem verrückten Wissenschaftler das Handwerk legen, der wiederum die Welt unter seine sinistre Herrschaft zu zwingen gedenkt? Basieren soll das Ganze auf Marvel-Comics, in denen die vier Musiker sich zuvor bereits als Superheros generierten; als Co-Produzent wird die vor allem für ihre Zeichentrickserien bekannte Konzern Hanna-Barbera ins Boot geholt. Das Ergebnis läuft zwar in manchen europäischen Ländern, darunter der BRD, tatsächlich im Lichtspielhaus, ist jedoch ursprünglich fürs Fernsehen konzipiert. Auch wenn die Kiss Army den original KISS MEETS THE PHANTOM OF THE PARK betitelten Streifen offenbar wie alles, worauf das Logo ihrer Lieblingsband prangt, als Kultobjekt verehren, verfällt meine Stirn nach Sichtung des Machwerks in noch stärkere Runzeln als beim Anhören jedes einzelnen Kiss-Albums, fühlt sich dieser Film doch mehr an wie ein Nagel in den Sarg einer sterbenden Band statt wie ein Promotions-Booster, mit dem neue Hörerkreise erschlossen werden können, und man seinen Status als Rock-n-Roll-Götter noch weiter festigt. Einmal ganz abgesehen von meiner mangelnden Sympathie für die musikalischen Ergüsse Kiss‘ ist KISS MEET THE PHANTOM OF THE PARK der wohl mit Abstand schlechteste Film, den ich mir dieses Jahr freiwillig angeschaut habe: Eine derart bierernst dargebotene Trash-Gurke, dass selbst unfreiwillige Komik kaum Chancen besitzt, Land zu gewinnen, realisiert ohne einen Funken künstlerisches Esprit, bei der man kaum glauben mag, dass zum einen der Brite Gordon Hessler auf dem Regiestuhl saß, der Ende der 60er, Anfang der 70er immerhin für angenehme Schauerware wie CRY OF THE BANSHEE oder THE OBLONG BOX verantwortlich zeichnete, und zum andern, dass Kiss‘ Management das desaströse Resultat nicht schnellstens in den Giftschrank verbannte, sondern wirklich auf die Menschheit losließ. Dass die Band selbst in späteren Interviews kein gutes Haar an dem Film lässt, und ihn Simmons gar mit Ed Woods PLAN 9 FROM OUTER SPACE vergleicht, spricht Bände.
Die Mär, die uns der Film erzählen möchte, lautet in groben Zügen wie folgt: Abner Deveraux, Ingenieur eines kalifornischen Freizeitparks, hegt ein düsteres Geheimnis. In den Katakomben seines Laboratoriums hat er eine Maschine erfunden, mit deren Hilfe er aus jedwedem Menschen einen willenlosen, sprich, allein ihm hörigen Roboter-Klon herstellen kann, (eben die titelgebenden „Phantome“). Auch sein Assistent Sam muss es sich gefallen lassen als Versuchskaninchen des mad scientist herzuhalten. Verzweifelt sucht fortan seine Liebste Melissa auf dem Vergnügungsgelände nach ihrem Herzblatt, während der Freizeitpark bereits von Kiss-Fans überschwemmt wird. Am Abend nämlich soll die Rockband in „Magic Mountain“ eintreffen und dreimal in Folge den Tagesausklang mit einem Konzert versüßen. Deveraux wittert, dass die halbgottgleichen Musiker einen Strich durch seinen Plan machen könnten, sich eine Armee an Robotern heranzuzüchten, mit denen er sodann zum Generalangriff auf die Menschheit blasen will. Als Melissa sich dann auch noch mit Gene, Paul, Ace und Peter anfreundet, und diese ihr zusichern, ihr bei der Suche nach Sam unter die Arme zu greifen, versucht Deveraux alles, um die Superhelden in Diskredit zu bringen. Hierfür konstruiert er zunächst ein Gene-Simmons-Double, das nachts marodierend durch den Freizeitpark zieht, Attraktionen zertrümmert, einen Haufen Polizisten vermöbelt. Am nächsten Morgen steht der Parkbesitzer neben dem Swimming Pools des Luxushotels, wo Kiss gastieren, und möchte wissen, was denn in ihren Demon gefahren sei, dass er derart ungezügelt seiner destruktiven Energie freien Lauf lässt. Kiss wiederum riechen schnell Lunte, dass ihnen da jemand Untaten in die Schuhe schieben möchte, um sie aus dem Verkehr zu ziehen. Wenn sie also nicht gerade allabendlich die Bühne rocken, bündeln sie ihre Superkräfte, um dem Wissenschaftler und seinen Zombies den Garaus zu machen. Diese Superkräfte wären: Gene kann Feuer spucken wie ein Flammenwerfer; Peter kann katzengleich kilometerweit in die Höhe springen; Pauls Augen sind Laserstrahlenkanonen; Ace letztlich verfügt über die Fähigkeit, sich und seine Freunde an jeden beliebigen Ort beamen zu können. Wenn KISS MEETS THE PHANTOM OF THE PARK bis hierhin noch nicht gewirkt haben mag wie eine zähe Geisterbahnfahrt, erweckt der Film diesen Eindruck spätestens in seinem letzten Drittel, das im Grunde aus einer losen Aneinanderreihung von Konzertaufnahmen und Duellen von Kiss mit allerhand albernen Puppen und Monstren besteht, die Deveraux in den Labyrinthen unterhalb des Freizeitparks auf unsere Helden hetzt: Knuffige Werwölfchen; das Frankenstein-Monster als Pappkamerad; sogar Laserschwertkrieger hat es aus dem STAR-WARS-Universum in diesen juvenilen, wenn nicht gar präpubertären Streifen verschlagen. Am Ende freilich laufen alle Fäden harmonisch beisammen: Kiss, die zwischenzeitlich von Deveraux gefangengenommen und durch Doppelgänger ersetzt wurden, zerschlagen ihre Klone auf offener Bühne; die Fans feiern diese Gefechte verzückt, da sie sie für Teil der Bühnenshow halten; Sam wird aus seinem Roboter-Dasein erlöst und kann Melissa in die Arme fliegen; im Abspann ertönt einer der besseren Kiss-Songs, in dem sich Gene Simmons als „God of Thunder“ hochstilisiert.
Handlungstechnisch kann auch gar nicht viel mehr über dieses sichtlich mit limitierten finanziellen Mitteln und wenig Gespür für eine aufreizende Dramaturgie inszeniertes Jahrmarktsspektakel gesagt werden: Die Figuren, allen voran Kiss, könnten eindimensionaler, skizzenhafter kaum sein; die Story wirkt wie eine Schnipselsammlung zerfledderter Comic-Hefte; die endlosen Live-Szenen sind reine Makulatur; schauspielerisch können Ace, Paul, Peter und Gene kein Bonsaibäumchen ausreißen. Dass der Film jedwede Gelegenheit verschenkt, das mythische Potential von Kiss in irgendeiner Form gewinnbringend zu nutzen, bleibt für mich unverständlich: Mit etwas Kreativität hätte man doch nun wirklich mehr aus einem Gespann aus Katzenmenschen, Dämonen und Sternenkriegern herausholen können, als dass man sie plump zu Superhelden erklärt, die ihre Fähigkeiten recht billig ausschauenden Talismanen verdanken, und gegen das Roboterheer eines verrückten Professors in die Schlacht ziehen lässt – Superhelden wohlgemerkt, die hauptberuflich in grellen Outfits im Scheinwerferlicht stehen und darüber singen, wie viele Frauen sie flachlegen wollen, flachlegen werden und schon flachgelegt haben. Nein, mit diesem Paradoxon werde ich mich niemals anfreunden. Aber das wäre noch alles zu verschmerzen gewesen, wenn denn KISS MEETS THE PHANTOM OF THE PARK wenigstens filmisch einigermaßen interessant ausgefallen wäre. Jedoch auch hier Fehlanzeige: Schon lange ist mir kein Streifen mehr unter die Augen getreten, der sich so sehr weigert, in seiner gesamten Mise en Scène auch nur zentimeterweise über den Tellerrand der stumpfesten Konvention zu linsen. Ich mag mir die Enttäuschung manches Kiss-Fans gar nicht ausmalen, der in den 70ern für vorliegendes Machwerk gar ein Kinoticket löst, und dann mit einem Film konfrontiert wird, der selbst für TV-Verhältnisse unbeschreiblich inspirationslos, um nicht zu sagen dilettantisch ausfällt.
Abschließend möchte ich noch auf die beiden Aspekte eingehen, die ich an KISS MEETS THE PHANTOM OF THE PARK am grausigsten fand: Zum einen die witzig sein sollenden One-Liner, die man unseren Heroen in den Mund legt. Als beispielweise die Polizei bei Kiss vorstellig wird, um Gene bezüglich der Zerstörungsorgie zu befragen, die sein Double nachts zuvor zelebriert hat, weist einer der Cops daraufhin, dass er den Dämonen exakt wiedererkenne, er müsse es gewesen sein, der im Schutz der Dunkelheit Amok lief, worauf Peter einwirft, das könne nicht sein, denn „Gene’s brother was an only child.“ Durchzogen ist der Film nicht nur von solchen Schenkelklopfern, sondern auch dem running gag, dass Gene in jeder sich bietenden Situation ein bedrohliches Growlen hören lässt. Pauls Kommentar zu diesem Löwengrummeln: „It must be feeding time for The Demon.” Alles an verbalen Kalauern in den Schatten stellt jedoch der sich nicht aus Kiss-Songs rekrutierende Instrumental-Score, mit dem man zum Beispiel die zahllosen Kämpfe zwischen Kiss und ihren Feinden unterlegt hat: Klänge wahlweise aus einem schlechten Spionage-Film oder einem Porno, - oder eben aus einem pornographischen Spionage-Thriller -, die mir in ihrer Beliebigkeit regelrechte Magenkämpfe bereiten, sodass ich mich doch ein einziges Mal im Leben nach Gassenhauern wie „Shout it out loud“ oder „I stole your love“ sehne. Wenigstens einen, sagen wir, süßen Moment hält indes auch diese audiovisuelle Bruchlandung bereit: Wie so oft stagniert die Handlung, damit die Band eins ihrer Stücke feilbieten darf, in diesem Fall Peter Criss‘ Ballade „Beth“, die der Katzenmann melancholisch im Mondschein trällert, während Paul die Klampfe zupft, und Ace und Gene mit traurig-nachdenklichen Mienen das Duo flankieren. Aber das sind nicht mal zwei Minütchen in einem ansonsten kaum konsumierbaren Werk, über das ich, wie man längst schon bemerkt hat, nun wirklich kaum etwas Gutes verlautbaren lassen mag.
Offenbar existiert KISS MEET THE PHANTOM OF THE PARK in mehreren Versionen, die sich dem Vernehmen nach stellenweise fundamental voneinander unterscheiden: Manche sollen ein alternatives Ende besitzen; andere sollen statt mit dem oben beschriebenen Muzak von Songs aus Gene Simmons‘ Soloalbum unterlegt sein; wiederum andere enthalten einen höheren Body Count, wenn auch ein paar Polizisten Deverauxs Machenschaft gewaltsam zum Opfer fallen. Gesichtet habe ich scheinbar die US-Variante, wie sie seinerzeit im TV ausgestrahlt worden ist – und, nein, mein Interesse, mir nun auch noch die europäischen Schnittfassungen zu Gemüte zu führen, tendiert gegen Null. Ein Satz in der Trivia-Abteilung des imdb-Eintrags zum Film fasst die Chose vielleicht am sinnfälligsten zusammen: „ All four members of KISS deeply regret that they acted in it. They hate the movie and still despise it being created.”