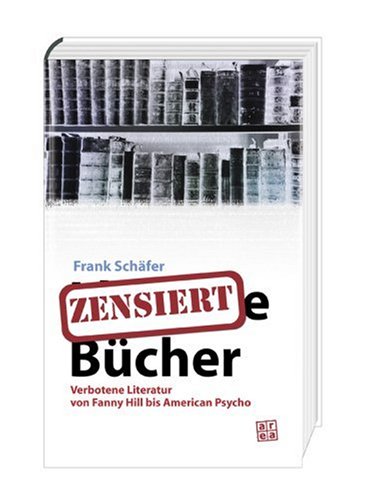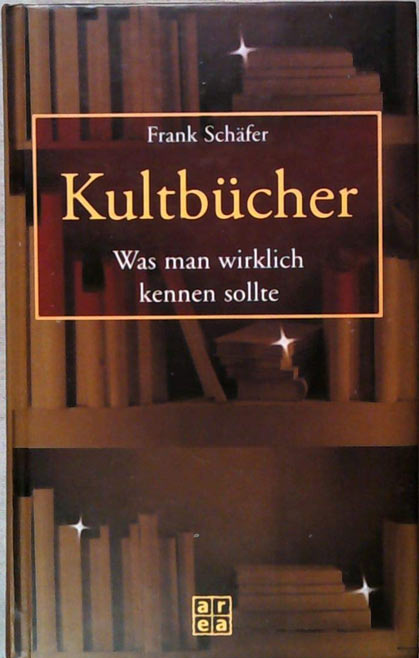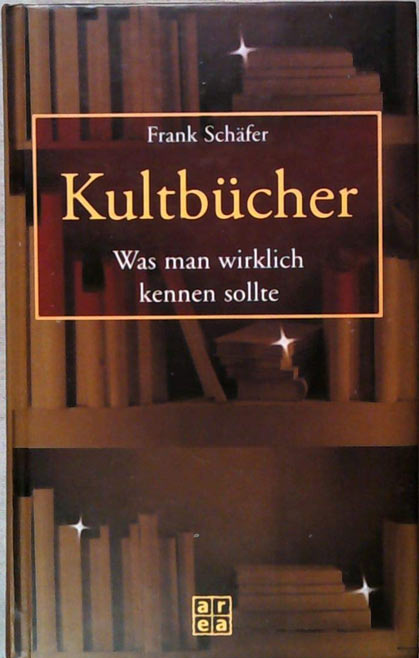
Frank Schäfer – Kultbücher. Was man wirklich kennen sollte
Kürzlich schrieb ich über Frank Schäfers im Erftstädter Area-Verlag erschienenes Werk „Zensierte Bücher“, in dem er mit einer Ausnahme (von der ich aus dem Stegreif gar nicht wüsste, um welche es sich handeln sollte) diejenigen Bücher aussparte, die der Braunschweiger Autor musik- und literaturzentrierter Sachbücher bereits in „Kultbücher“ besprochen hatte. „Kultbücher“ war im Jahre 2000 ursprünglich bei Schwarzkopf & Schwarzkopf erschienen, in der verbesserten, stark erweiterten Neuauflage, die Gegenstand dieser Rezension ist, jedoch erst 2005, nun ebenfalls bei Area. Der 400-seitige Umfang des gebundenen Wälzers entspricht dem von „Zensierte Bücher“, vorgestellt und besprochen werden von Schäfer sage und schreibe 71 Werke.
Einleitend stellt Schäfer acht sehr richtige Thesen zum Thema auf, um anschließend in chronologischer Reihenfolge in die Vollen zu gehen: In knapper Essay-Form kanonisierend, sortiert er die Bücher in ihren jeweiligen historischen Kontext ein. Doch handelt es sich tatsächlich allesamt um Kultbücher? Nun, mit „kennen“ meint Schäfer mitnichten „lieben“ und reflektiert seinen Kanon kritisch, statt ihn oberflächlich abzufeiern (oder „abzukulten“).
So zitiert er Arno Schmidts Herausarbeitungen der Homoerotik, die Karl May – aus bestimmten Gründen? – seiner Winnetou-Figur angedeihen ließ, und übt scharfe Kritik an Rudyard Kiplings Dschungelbüchern:
„Hier wird der Lesejugend die streng hierarchische, imperialistische Weltsicht des viktorianischen Großbürgertums eingebimst (…).“ (S. 24) Hochinteressant wird es bei Karl Kraus‘ „Die Fackel“, den Schäfer als frühen Kämpfer für sexuelle Selbstbestimmung, pressekritischen Sprachkritiker und wortgewaltigen Kriegsgegner während des
Ersten Weltkriegs adelt. Es geht also keinesfalls darum, einer breiten Masse liebgewonnene Bücher systematisch zu besudeln und zu verreißen. Sherwood Andersons „Winesburg, Ohio“ interpretiert er relativ anspruchsvoll philosophisch, macht klar, welch Faschist und Schlächter Ernst Jünger war, und arbeitet aus Hermann Ungars „Die Verstümmelten“ die sexualpsychopathologische und homosexuelle Ebene heraus. Walter Serners „Die Tigerin“ beschreibt er als stilistisch mutige, abseitige Liebesgeschichte mit einer im Wortsinn ganz eigenen Sprache. Den russischen „Alle Fälle“-Autor Daniil Charms stellt Schäfer als Initiator der
Neuen Form vor, der unter dem stalinistischen Terror zu leiden hatte und ihn nicht überlebte. Er bricht eine Lanze für die Naivität und rührende Schönheit Pus des Bären von Alan Alexander Milne und zitiert in diesem Zusammenhang Harry Rowohlt.
Ein weiteres „Kultbuch“, mit dem Schäfer abrechnet, ist John Cowper Powys‘ „Wolf Solent“ aufgrund dessen Fortschritts- und Wissenschaftsfeindlichkeit. Wilhelm Reichs Sachbuch „Die sexuelle Revolution“ nimmt er zum Anlass, zu beleuchten, wie man Sexualrevolutionär Reich während der NS-Diktatur fertigmachte, worüber dieser anscheinend den Verstand verlor und zum Esoterikspinner mutierte. Er nähert sich James Joyces „Finnegans Wake“ an, ruft anlässlich „Ich – Arturo Bandini“ John Fante als herausragenden Literat italienischer US-Immigranten, dessen Werke auch Bukowski gefielen, ins Gedächtnis, und geht dabei auch auf Fantes Sohn ein. Antoine de Saint-Exupérys Kinderbuch „Der kleine Prinz“ klassifiziert Schäfer als Geschichte über sonderbare Außenseiter und die Kraft der Freundschaft. Woodys Guthries Autobiographie „Bound for Glory“ umschreibt er als gossenpoetisches
„Sittenbild der Unterschichten in den 20er und 30er Jahren“.
Die Nachkriegszeit eröffnet Schäfer mit Salingers „Der Fänger im Roggen“, einem Bildungsroman übers Erwachsenwerden und
„den Antagonismus von Kunst und Leben“. Ian Flemings „James Bond“-Romane kritisiert er für ihren Schreibstil, vor allem aber für ihre reaktionären und sexistischen Inhalte – danke dafür, Frank! J.R.R. Tolkiens „Der Herr der Ringe“ scheint nicht sein Fall zu sein, offenbar erlag er dessen Faszination nicht. (Da ich fürchte, dass es mir ähnlich erginge, habe ich es trotz gefühlten sanften gesellschaftlichen Drucks noch immer nicht gelesen.) Zurecht wesentlich mehr anfangen kann Schäfer mit Philip K. Dicks klugen Science-Fiction-Dystopien, mit denen
„die ästhetische Moderne im Science-Fiction-Genre Einzug“ gehalten habe. Seinen verfilmungskritischen Passus zu „Minority Report“ kannte ich allerdings schon aus einer seiner Essay-Sammlungen. Anhand „Jerry Cotton“ bricht er eine Lanze für Heftromane und sprach mit deren fleißigstem Verfasser Friedrichs, was mir aus „Homestories – Zehn Visiten bei Schriftstellern“ ebenfalls bereits bekannt war. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich in einem seiner anderen Bücher auch schon seine Auseinandersetzung mit Nabokovs „Lolita“ gelesen. Doch Redundanz ist die Mutter der Didaktik, also sei’s drum.
Ginsbergs „Howl“ hebt Schäfer als lyrisches Manifest der Beat-Generation hervor, Kerouac charakterisiert er als naiv-träumerischen, konservativ-regressiven Beat-Autor. Er kommentiert die Werke des psychisch schwerkranken Robert Lowry, um schließlich eingehender auf sein vermeintlich antisemitisches „Lebendig begraben“ einzugehen und es von diesem Vorwurf freizusprechen. Das satirische und humoristische Potenzial von „Naked Lunch“ erkennt Schäfer, bleibt aber leider eine Antwort darauf schuldig, inwieweit Borroughs
„reaktionäre Anwandlungen“ gehabt habe. Sein Essay über Ken Keseys „Einer flog über das Kuckucksnest“ ist leider fast ausschließlich eine Zusammenfassung des Inhalts, zudem ohne ein Wort über die fulminante Verfilmung zu verlieren. Und kenne ich seinen Text über Anthony Burgess‘ „A Clockwork Orange“ nicht auch schon? Wie dem auch sei: Schäfer ehrt den Roman als Plädoyer für die Wahlfreiheit des Menschen und gegen Totalitarismus. Harold Brodkeys „Unschuld“ hingegen verreißt er aufgrund dessen pubertärer, dusselig verliebter Sprache – obwohl mir die Zitate sehr zusagen. Sie lesen sich wie authentisch im Affekt geschrieben. Es folgt ein Loblied auf Charles Webbs „Die Reifeprüfung“ und dessen
„liberalistische Intention“. Folk-Nuschler Bob Dylans „Tarantula“ wiederum ist offenbar unlesbarer Schwachsinn, was auch Schäfer vermittelt.
Sein Text über Richard Brautigans „Forellenfischen in Amerika“ verhandelt jenes Buch als mit der Hippiezeit korrespondierende, abermalige Sinnsuche in den mythologisierten USA in Form schräger Prosa, von der Schäfer begeistert ist, bei der ich jedoch abwinke. Hubert Fichtes „Die Palette“ skizziert er als
„lapidares, teilnahmsloses, wenn nicht indolentes Stenogramm“, für dessen Stil er Verständnis äußert, ihn aber trotzdem bedauert. Der gute alte Charles Bukowski gefällt ihm, und so verteidigt er ihn gegen elitäre Behauptungen, er sei ach so antiliterarisch. Aus der Beat-Anthologie „Acid“ zitiert Schäfer die unfreiwillig komisch anmutenden Thesen Staffords und kommentiert sie sarkastisch. Günther Amendts „Sex Front“ sei ein freches, gelungenes Aufklärungsbuch – und auch, wenn man längst alles weiß, könnte es offenbar Freude bereiten, es einmal zu lesen.
Schäfers Essay zu Arno Schmidts „Zettels Traum“ weist die Struktur eines Dramas auf, das ein universitäres Gespräch abbildet, in dem Schäfer in die Rolle des Germanistik-Dozenten schlüpft, weit ausholt und Schmidt ästhetischen Nonkonformismus attestiert, bevor er zu dessen
Opus magnum „Zettels Traum“ kommt. Das dürfte eher nichts für mich sein, denn schon das Lesen dieses Essays voller verquaster Verklausulierungen ist unnötig anstrengend – zumal es sich seitens Schmidt offenbar um einen Versuch handelte, E.A. Poe die Ehre abzuschneiden. Immerhin äußert Schäfer Kritik an Schmidts altersreaktionären Ressentiments.
In Hunter S. Thompsons „Angst und Schrecken in Las Vegas“ erkennt er eine ambivalente Aussage, schreibt daher von einer humorvollen Drogen-Apotheose und -Kritik zugleich sowie vom Abgesang auf die Hippies. Peellaerts und Cohns „Rock Dreams“ sei gar eine Illustration des Untergangs des Rock'n'Rolls und Jörg Schröders „Siegfried“ eine bewusst
trashige, anarchische, aber auch eitle Abrechnung mit dem damaligen Literaturbetrieb. Helmut Salzinger sei ein seine Hoffnung in die „Yippies“ setzender Musikkritiker und -diskutant, der auf mich aber wie ein nerviger Hippie-Laberkopp wirkt. So oder so wurde er hoffnungslos von der Zeit niedergewalzt. Jerofejews „Die Reise nach Petuschki“ ist laut Schäfer ein russischer Suffroman voller russischem Weltschmerz, über den er gern noch mehr wissen würde – wie er abschließend durchblicken lässt. Ein Kuriosum unter den „Kultbüchern“ ist Heino Jaegers „Alkoholprobleme in Dänemark“-Schallplatte (!), offenbar ein herausragend komisches Spiel mit der Sprache.
„Gedichte/Lieder“ Wolf Wondratscheks seien überraschende Gedichtbände, Verena Stefans „Häutungen“ ein anscheinend gar nicht mal so gutes erstes literarisches Werk der Frauenbewegung in den 1970ern und Raymond Federman mit „Take it or leave it“ einer der zurecht bekanntesten Vertreter der literarischen Postmoderne gewesen. Auf S. 277 war Schäfer schon beim Feierabendbier, das hoffentlich kein
„Giftpils“ war. Nichtsdestotrotz arbeitet er aus Bernward Vespers „Die Reise“, eine Art stellvertretender
RAF-Terroristen-Biographie, sehr schön die Ambivalenz nicht nur dieser Figur heraus. Eckhard Henscheids „Geht in Ordnung – sowieso - - genau - - -“ sei für Schäfer ein empathisches humanistisches Denkmal für dämliche Kneipen-Dampfplauderer, auch wenn sich die Zitate eher sozialchauvinistisch herablassend für mich lesen. Uli Beckers
„Gelegenheitsgedichte im besten Sinne“ aus „Meine Fresse!“ betrachtet Schäfer als Porträt des desillusionierenden Teils der 1970er und Brinkmanns
„katastrophistische“ Text-Bild-Collage „Rom, Blicke“ als
„rücksichtsloses und nachgerade dokumentarisches Stenogramm“. „Fuck off, Amerika“ aus der Feder Eduard Limonows attestiert Schäfer, ein
„emotionaler Blitzableiter, zugleich aber auch ein aufrichtiges, sich selbst nie schonendes, die eigene Hybris, Ehrpusseligkeit und Larmoyanz nie beschönigendes Protokoll einer Selbstbehauptung“ zu sein, geizt dabei aber nicht mit Kritik am Autor.
Douglas Adams‘ Science-Fiction-Komödie „Per Anhalter durch die Galaxis“ sieht Schäfer ungewohnt kritisch, Jörg Fausers „Der Schneemann“ ordnet er als etwas undurchsichtigen Schelmenkrimi und Stenogramm des Dekadenwechsels zu den 1980ern ein und Rainald Goetz‘ „Irre“ als Infragestellung der Psychiatrie, aber auch Abgesang auf salonrevolutionäre Träumereien vom künstlerischen und revolutionären Potential Irrer – mit einem schwachen dritten Teil. Jim Dodges „Fup“ sei eine Art Erwachsenenmärchen, Gibsons „Neuromancer“ darf als Cyberpunk-Pionier nicht fehlen und Bret Easton Ellis‘ „Unter Null“ ist offenbar ein „American Psycho“-Vorläufer in Sachen Abrechnung mit den Yuppies. Philippe Djians „Betty Blue. 37,2° am Morgen“ mag Schäfer sehr, unterstellt aber beinahe Voyeuristisches beim Lesen. Wolfgang Welt mit seiner „Peggy Sue“ scheint mir ein ungefickter Journalist zu sein, der seinen persönlichen Frust in Musikkritiken auf andere projiziert, woraus eine Art unsympathischer Verliererprosa wird, was Schäfer in seinem wohlwollenden Essay zumindest anklingen lässt. Bei dieser Gelegenheit: Was soll eigentlich immer dieses Abarbeiten an Heinz Rudolf Kunze? Er schenkte uns immerhin die Evergreens „Dein ist mein ganzes Herz“ und „Finden sie Mabel“ – und was danach so alles aus Deutschland die Charts erklomm, war doch wohl zu großen Teilen wesentlich schlimmer. M.A. Numminens „Der Kneipenmann“ ist laut Schäfer so etwas wie ein ehrerbietendes Soziogramm finnischer Unterschichtstrinker – und damit der Gegenpol zu Henscheid?
Joachim Lottmanns „Mai, Juni, Juli“ definiert Schäfer als ersten deutschen Poproman, ein
„fulminante(s) Stück Prosa“, das
„nicht nur treffsichere(s) Szene- und Zeitdokument, sondern auch postmodernes Patchwork, ein Roman aus angefangenen Romanen“ sei. In Andreas Mands „Grovers Erfindung“ erkennt er nicht weniger als die Wiederauferstehung vergessener sensorischer, emotionaler, transzendentaler Potenziale der Kindheit, einen ebenso witzigen wie soziologisch interessanten und inhaltlich wie sprachlich überaus präzisen Roman über die Kindheit in den 1960ern. Mit „Generation X“ setze sich Douglas Coupland unklug zwischen die Stühle und biete
„für einen Essay (...) einfach zu wenig Analyse – und für einen Roman zu viel.“ Irvine Welshs „Trainspotting“ lasse sich als verstörende und provokante
„Apologie des Drogenkonsums“ zusammenfassen und Tobias Wolff Kriegserinnerungen „In der Armee des Pharaos“ als aus einer Dummheit heraus geborenes
„deutlich Grausamkeit und Sinnlosigkeit [des US-Angriffskriegs auf Vietnam] spiegeln[des]“ Buch – weshalb dieses erst so spät, nämlich 1994, erschien, erfährt man leider nicht.
Kinners, wir ham’s gleich! Die letzte Rutsche: Nick Hornbys „High Fidelity“ beschreibt Schäfer als listenreiche, kluge Pop- und Erwachsenwerdungs-Prosa, deren auch von ihm erwähnte Erzählerlarmoyanz mir jedoch derart das Vergnügen trübte, dass eine Identifikation schwer- und mir die Verfilmung daher tatsächlich besser gefiel. McNeils und McCains US-Urpunk-
Oral-History „Please Kill Me” empfinde Schäfer als spannend und souverän geführt, Stuckrad-Barres „Solocalbum“ hingegen als „Zeugma-lastigen, sprachlich ansonsten uninteressanten und inhaltlich abgeschmackt-polemischen, schaumschlägerischen Poproman über einen Teil der 1990er und das Herzeleid des Erzählers – touché! Aus ungefähr diesen Gründen, die sich mit meinen Befürchtungen decken, habe ich‘s bisher nicht gelesen, obwohl es eigentlich meine Kragenweite sein sollte. Große Lyrik mit
„schier überbordende[m] Storytelling“ sei Fredy Neptunes „Am Fleischwolf“, Poesie auf bewusst
„niederer Stilebene“ Forrest Gumps und Co. über die Grausamkeit des Menschen und die für mich unvorstellbare Möglichkeit, ihm zu verzeihen. Mit J.T. Leroys „Sarah“ stellt Schäfer zudem einen
„so unbeschwert“ erzählten Roman
„als ginge es um Burgenbauen im Sandkasten“ über pädophile und schwule Elendsprostitution vor, der offenbar autobiographisch und -therapeutisch, in
„kindlich-glättende[m], harmonisierende[m] Erzählgestus“ verfasst ist. Frank Schulz‘ „Morbus fonticuli oder Die Sehnsucht des Laien“ sei ein
„ebenbürtige[r], nein, bessere[r] Nachfolger“ des
„besten deutschen Trinkerroman(s) aller Zeiten“ – schade, dass er über diesen nicht auch geschrieben hat –, ein Roman über ein dem Wahnsinn verfallenden Schriftsteller, der zu lange gezwungen ist, Zeit und Talent für Anzeigenblättchen zu verschwenden. Und noch interessanter liest sich Schäfers Abhandlung über Matias Faldbakkens seine eigene Rezeptionsgeschichte vorwegnehmenden, schwerst beleidigenden Anarcho- und Pornoroman „The Cocka Hola Company“, den ich unbedingt werde lesen müssen.
Zugegeben, mitunter spoilert Schäfer nicht zu knapp. Andererseits ist „Kultbücher“ zumindest für mich auch ein Buch, das man liest, um einen nicht unbeträchtlichen Anteil der besprochenen Bücher nicht lesen zu müssen. So manch eines macht Schäfer einem aber schmackhaft und gibt sich dabei durchaus angriffslustig und streitbar, scheut sich nicht, manch heilige Kuh zu schlachten und zitiert gern aus Kritiken, um diesen zu widersprechen. Das liest sich nicht zuletzt wegen seiner Fabulierkunst ebenso informativ wie unterhaltsam, wenn er es nicht gerade wie für ihn typisch mit den seltsamen Wörtern übertreibt:
Panegyrikos (antike Prunkrede),
spinozistisch (de Spinozas Lehren ablehnend/abwertend),
defätistisch (resignativ),
Suada (Redeschwall, Beredsamkeit) und
Vademekum (Leitfaden) habe bestimmt nicht nur ich vorher nie gehört und
„Fürnehmkeit“ (S. 385) muss er sich selbst ausgedacht haben, Google liefert exakt 0 (null) Treffer.
Zum Inhalt: Natürlich kann Schäfer nicht über jedes Buch schreiben, das von einer kleineren oder größeren Leserschaft zum Kultobjekt erklärt wird. Aus seiner spitzen Feder hätte ich beispielsweise aber gern auch über Christian Kracht gelesen. Dass Lovecraft komplett ausgespart wurde, irritiert mich noch mehr, und meine leise Hoffnung, dass Schäfer Stephen Kings „Es“ berücksichtigt haben könnte, wurde nicht erfüllt – obwohl durchaus Parallelen zwischen Schäfers sporadischem belletristischen Schaffen und Kings
Coming-of-age-Epos erkennbar sind. Davon unabhängig überwiegt bei Weitem der positive Eindruck, den die „Kultbücher“-Lektüre hinterlassen hat, denn dümmer macht sie ganz bestimmt nicht. Und Respekt dafür, all diese Bücher wirklich gelesen zu haben…