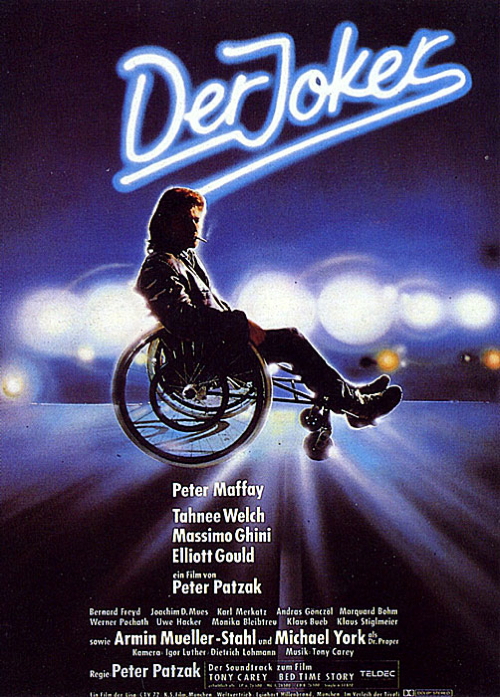Kick-Ass
„Ich frag mich, warum das noch niemand vor mir gemacht hat!“Wer wäre nicht gern ein Superheld? Die Bösen verdreschen, die Guten beschützen - davon träumt auch Dave Lizewski (Aaron Johnson), ein unauffälliger, normaler High School-Schüler, nicht sehr beliebt, nicht allzu sehr beachtet von den Mädchen, wie so viele vor und nach ihm. Aber Dave ist nicht wie die Anderen: er besorgt sich einen grünen Neoprenanzug und eine Maske, tauft sich auf den Namen Kick-Ass und zieht hinaus in die Nacht, um Verbrecher zur Strecke zu bringen, gänzlich ohne jegliche Superkräfte oder sonstige erwähnenswerte Fähigkeiten. Von Kampfkünsten mal abgesehen, denn seine ersten Einsätze bringen ihm vor allem eins ein: was aufs Maul. Aber Dave macht unverdrossen weiter, wird via Web und Youtube zu einer populären Figur und fällt so dem Ex-Polizisten Macready (Nicolas Cag) auf, der gerade seine elfjährige Tochter Mindy (Chloe Moretz) zu einer eiskalten Killerin ausgebildet hat und mit ihr zusammen als "Bid Daddy" und "Hit Girl" auf Superheldentour geht, um sich für ein Unrecht zu rächen, das ihn die Frau und die Karriere gekostet hat. Und mit dem jungen "Red Mist" findet Dave (Christopher Mintz-Plasse) tritt anscheinend gleich noch ein Nachahmer an, mit dem man Gangsterboss D'Amico (Mark Strong) auf die Füße treten kann - doch der hat andere Beweggründe und die Sache wird zunehmend ernst...
Die nach „Layer Cake“ und „Der Sternwanderer“ dritte Regiearbeit des US-Amerikaners Matthew Vaughn ist der im Jahre 2010 veröffentlichte Superhelden-Streifen der etwas anderen Art, „Kick-Ass“, eine Verfilmung der (mir unbekannten) Comic-Reihe, die sich parodistisch mit dem Phänomen des (Super-)Heldentums auseinandersetzt. Damit wurde „Kick-Ass“ für mich interessant, denn mit Realverfilmungen von Comics tue ich mich ansonsten sehr schwer und meide i.d.R. hochbudgetierte, unwahrscheinliche Action-Verfilmungen im Blockbuster-Gewand. Ausnahmen bestätigen dabei die Regel und einen Neo-Noir à la „The Dark Knight“ lasse ich mir durchaus schmecken.
High-School-Schüler Dave Lizewski (Aaron Johnson, „Chatroom - Willkommen im Anti-Social Network“) ist Halbwaise, hat schwer mit der Pubertät zu kämpfen und träumt davon, seinem unauffälligen Leben, das ihm bislang auch nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit der holden Weiblichkeit beschert hat, zu beenden. Eines Tages schlüpft er dann tatsächlich in einen grünen Neoprenanzug und macht sich auf, als „Kick-Ass“ das Verbrechen zu bekämpfen. Dumm nur, dass Dave über keinerlei sonderlich herausragende Fähigkeiten verfügt, von Superkräften ganz zu schweigen, und so endet sein erster Einsatz dann auch gleich mit einem Messer im Körper. Doch die „Generation Internet“ ergötzt sich an Youtube-Videos seiner Aktivitäten und tritt einen Hype um seine Person los. Während Dave noch immer der unscheinbare Schüler ist, avanciert sein Alter Ego zum Medienstar. Das erzeugt schließlich auch die Aufmerksamkeit des ehemaligen Polizisten Macready (Nicolas Cage, „Bringing Out the Dead“) und seiner gerade einmal elfjährigen Tochter Mindy (Chloë Grace Moretz, „Amityville Horror - Eine wahre Geschichte“), die ein tatsächliches maskiertes Helden-Duo bilden und als „Big Daddy“ und „Hit Girl“ sportlich topfit und bis an die Zähne bewaffnet daran arbeiten, die Schmach, die Macready seine Frau und seinen Job gekostet hat, zu sühnen. Doch auch der höchst kriminelle Gangsterboss D'Amico (Mark Strong, „Oliver Twist“) wird auf „Kick-Ass“ aufmerksam, sieht durch ihn seine Geschäfte gefährdet und ist noch einmal ein ganz anderes Kaliber als kleinkriminelle Strauchdiebe auf der Straße. Er setzt seinen Sohn (Christopher Mintz-Plasse, „Year One - Aller Anfang ist schwer“) als vermeintlichen Helden „Red Mist“ auf „Kick-Ass“ an, wodurch Dave in ernsthafte Schwierigkeiten und schließlich in Lebensgefahr gerät…
Mit frecher, unverblümter Sprache führt Vaughn in seine Geschichte ein, die schon früh überraschend brutal ausfällt und einen fast schon zynischen, schwarzhumorigen Umgang mit dem Tod von Menschen etabliert. Wer familiengerechte, saubere Superhelden-Unterhaltung erwartet, wirft bereits hier das Handtuch, alle anderen bleiben dran und lassen sich vom angenehm unvorhersehbaren Handlungsverlauf immer wieder aufs Neue überraschen. „Big Daddy“ und „Hit Girl“ erweisen sich als waffenvernarrter Vater und um ihre unbeschwerte Kindheit beraubte Tochter, die zur kaltblütigen Killermaschine ausgebildet wurde. Beide hegen demnach ein bizarres, äußerst fragwürdigen Verhältnis zueinander und gehen mit höchster Brutalität gegen Verbrecher vor. Teil des parodistischen Ansatzes des Films ist es, dass Vaughn dies so stehen lässt und mit keiner Silbe verurteilt, womit er sich ein gutes Stück weit satirisch mit klassischen Kostümhelden-Motiven wie „Batman & Robin“ auseinandersetzt. Damit verfolgt „Kick-Ass“ den Ansatz, nicht nur auf die Komik zu setzen, die damit einhergeht, dass ein frustrierter Jugendlicher ohne besondere Fähigkeiten in ein Ganzkörperkostüm schlüpft und sich ordentlich eins auf die Glocke hauen lässt, sondern auch die Umtriebe tatsächlicher ausgebildeter „Helden“ zu persiflieren – was darauf hinaus läuft, dass in Hochglanzoptik ein Menschenleben nach dem anderen ausgelöscht wird, das CGI-Blut nur so spritzt und sich unweigerlich Fragen nach der Rechtfertigung für diese Art der Selbstjustiz stellt, ohne dass der Film diese ausformulieren und dafür sein oberflächlich betrachtet immer härter werdendes, heillos übertriebenes und explosives Action-Spektakel unterbrechen würde.
Aufgepeppt wird die Sause durch reichlich visuelle Spielereien und Effekte wie beispielsweise der Schießerei mit Nachtsichtbrille in Ego-Shooter-Perspektive und anderer kreativer Elemente, um sich auch ja das dauerhafte Interesse eines reizüberfluteten adoleszenten Publikums zu sichern. Aber auch erwachsene Zuschauer dürften großen Gefallen am überspitzt-übertriebenen Overkill haben, den der Film in mehrerer Hinsicht bietet – zumindest sofern ein Mindestmaß an Vertrautheit mit den hier verarbeiteten Versatzstücken und Klischees aus zahlreichen Comic-Reihen gegeben ist. Einen leichten Durchhänger leistet sich der Film, nachdem es zu einem tragischen Todesfall auf Seiten der „Guten“ gekommen ist. Die Luft ist kurz ein bisschen raus – und wie sollte das vorausgegangene Massaker noch zu übertrumpfen sein? Vaughn entscheidet sich, „Kick-Ass“ einen nun vollends abwegigen und ins Reich der Fantasie gehörenden Showdown zu spendieren, der jedoch nicht mehr und nicht weniger als eine wahre Metzelorgie wird. Der Soundtrack zitiert derweil Ennio Morricones Komposition aus „Für ein paar Dollar mehr“ und macht auch ansonsten sehr viel Spaß mit seinem bunten Streifzug von Mozart über Rock’n’Roll, Glam und Punk bis Danny Elfman. Viel mehr verraten möchte ich über „Kick-Ass“ gar nicht, um nicht die vielen kleinen und größeren Überraschungen, die er zu bieten hat, zu untergraben. Erwähnenswert wäre vielleicht noch, dass er von den Comicvorlagen mitunter stark abweichen soll und das Konzept seiner wohlgestreuten Brüche mit Genrekonventionen und auch manch Tabu letztlich nicht in voller Konsequenz durchhält, es am Ende eben gut mit seinem Publikum meint, statt zu den ganz fiesen Magenschwingern auszuholen – als einen solchen dürften diejenigen, die mit der Erwartungshaltung einer „herkömmlichen“ Superhelden-Verfilmung oder einer seichte Komödie an diesen Film herangegangen sind, „Kick-Ass“ ohnehin schon empfinden. Und wer am Ende dann doch gar nichts von all dem versteht oder verstehen will, bekommt immerhin eine riesige Action-Party und gut aufgelegte Schauspieler geboten, von denen ausgerechnet ein kleines Mädchen alle an die Wand spielt (und abdrückt). Und wer’s noch konsequenter, dafür dreckiger und undergroundiger mag, greift zum ungefähr zeitgleich entstandenen „Super“.