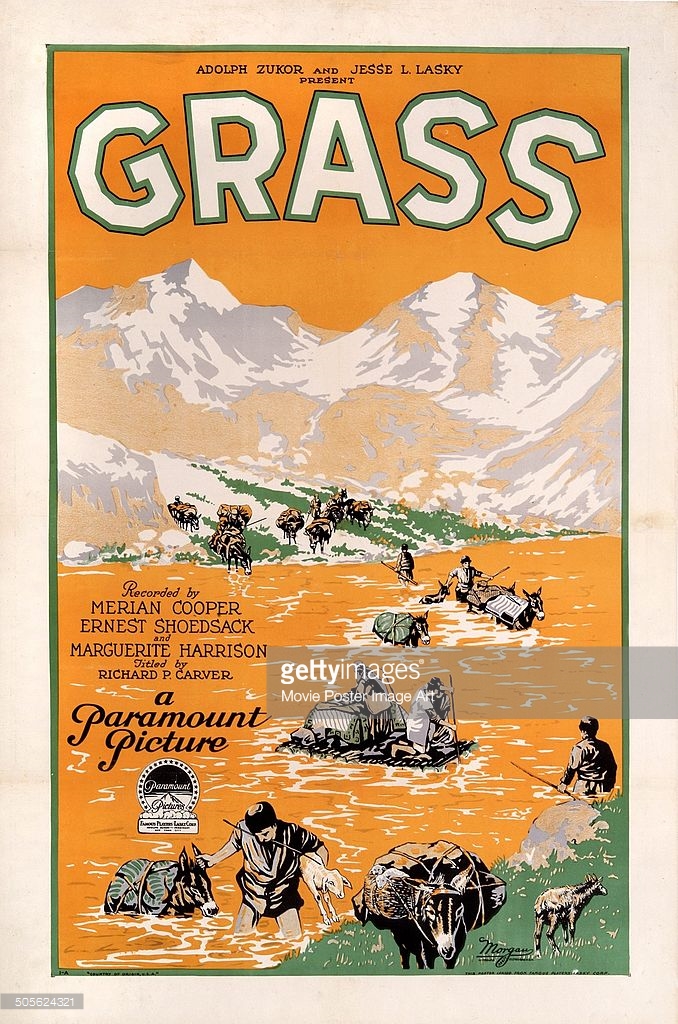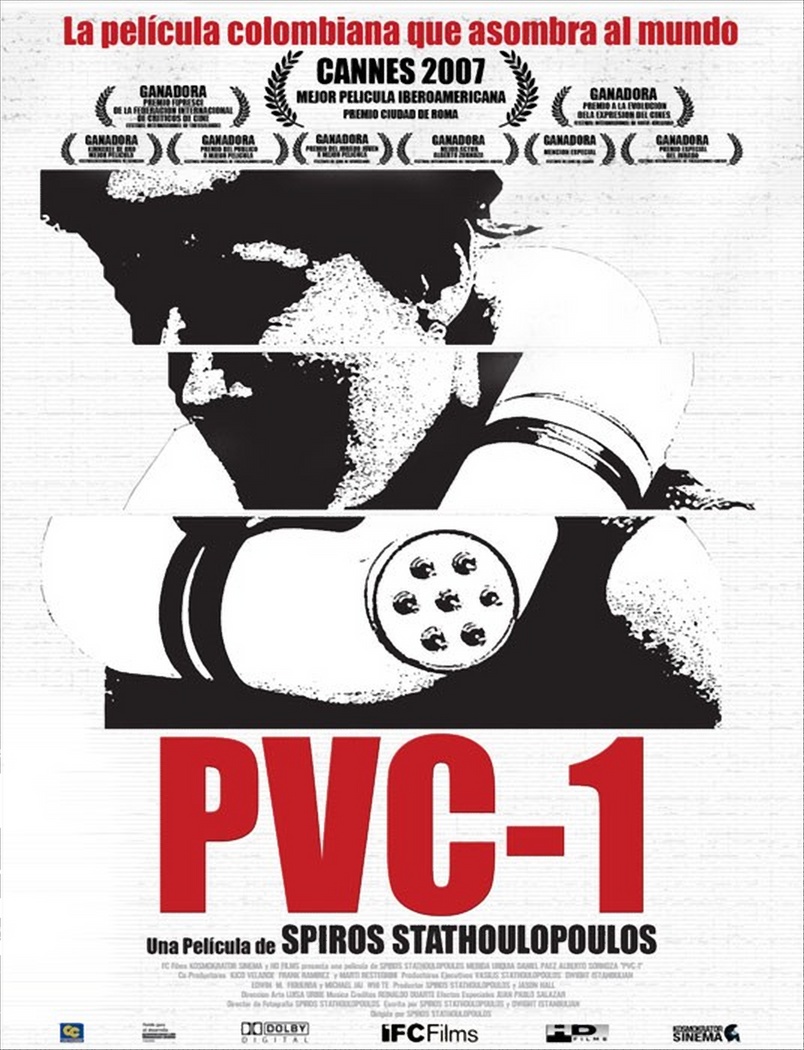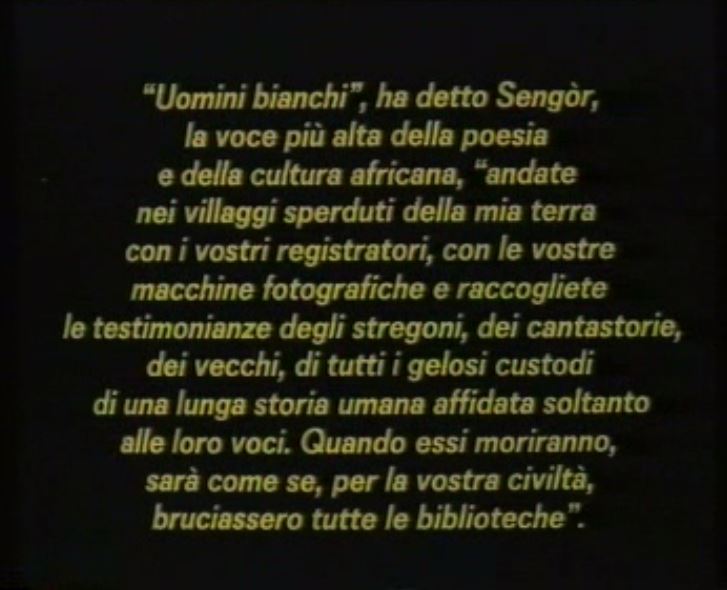Re: Salvatores Skizzen zu einer Studie der absoluten Kontingenz
Verfasst: Mo 20. Nov 2017, 18:47

Originaltitel: Primer
Produktionsland: USA 2004
Regie: Shane Carruth
Darsteller: Shane Carruth, David Sullivan, Casey Gooden, Anand Upahhyaya
Eine Szene dieses Jahr in München: Ich sitze mit zwei Forenmitgliedern vor einem Asia-Restaurant nur wenige Meter vom Kino entfernt, in dem gleich der Elio Petri beginnen wird. Irgendwie – ich weiß nicht, weshalb – fängt einer von uns damit an, über einen Film zu erzählen, von dem ihm im Moment weder Titel noch Regisseur einfällt. Es soll dort aber um Zeitreisen gehen, nur nicht im großen Stil wie bei H.G. Wells: Keine Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende sollen überbrückt werden, sondern ganz kurze Distanzen, zehn Minuten, oder sechzig, oder vierundzwanzig. Eine Gruppe Studenten forsche in diesem Film zum Thema Zeitreisen, und konstruiere irgendwelche seltsamen Boxen, in die man sich hineinlegen und dort lange Zeit verharren müsse, um dann als Replikat seines eigentlichen Selbst in der Zukunft aus ihnen heraussteigen zu können, doch dem Zuschauer, sagte derjenige, sei lange Zeit völlig ungewiss, an was diese Studenten denn da überhaupt forschten, und erst nach einer Weile kristallisiere sich heraus, worauf der Film denn hinauslaufe, und dann sei er verwirrend und schön.
Vor einigen Jahren, als ich mich vermehrt bei den Raumfahrtingenieuren einer gewissen mittelhochdeutschen Technischen Universität herumtrieb, löcherte ich einen der Leiter des Instituts für Raumfahrtforschung mit wohl für ihn ziemlich naiven Fragen. Ob ein Mensch, wenn er es denn nur wolle, hunderte von Jahre alt werden könne. Ob es sein könne, dass Außerirdische in Verkleidung bereits unter uns lebten. Natürlich auch, ob das möglich sei, in der Zeit herumzureisen. Seine Antwort war so präzise wie klug: Da das Universum sich, nach derzeitigem Stand der Forschung, permanent ausdehne, machten Zeitreisen überhaupt keinen Sinn, denn niemand wisse, wo er denn herauskommen würde, wenn er jetzt an einem Punkt A in eine Zeitmaschine steige, und mit ihr, sagen wir, bis zum Antiken Sparta reise, und dort an einem Punkt B ankomme, denn dieser Punkt B könne, aufgrund besagter Expansion aller Materie, irgendwo im Nichts liegen, im luftleeren Raum, im Kosmos. Auch kürzere Distanzen seien bereits eine Schwierigkeit: Woher weiß ich denn, wenn ich heute in diesem Park hier in eine Zeitmaschine steige, und mich fünfzig Jahre in die Vergangenheit katapultiere, dass genau auf derselben Stelle damals nicht ein Baum gestanden hat? Im Grunde müsste ich meine Maschine an einem Ort aufstellen, der völlig meiner Kontrolle unterworfen ist, und von dem ich genau weiß, dass sich nur dann in ihm etwas verändert, wenn diese Veränderung von mir selbst ausgeht. Aber sowieso, sagte er, sei das mit Zeitmaschinen reine Phantasterei. Wenn überhaupt, könnte mir ein Schwarzes Loch bei der Überwindung räumlich-zeitlicher Grenzen helfen, doch bis ich bis zum Epizentrum eines solchen hingelangt sei, wäre ich, würde ich heute von der Erde aus mit einem Raumschiff starten, schon längst verstorben.
In PRIMER funktioniert es allerdings. Das mit den Zeitmaschinen – es sind Boxen, deren Funktionsweisen ich beim besten Willen nicht begriffen habe -, und das mit den Zeitreisen – auch wenn ich wohl noch ein Jahr mich mit diesem kleinen, wundervollen Film beschäftigen muss, um zu begreifen, wie viele genau die Protagonisten denn nun unternehmen, und wie viele Duplikate ihrer selbst deshalb irgendwo in der filmischen Diegese herumlaufen. Dabei ist die Handlung, runtergebrochen aufs Basalste, schon fast schlicht: Da ist Aaron – gespielt von Regisseur, Drehbuchautor, Produzent, Cutter, Filmkomponist Shane Carruth, der den Terminus der Personalunion kurzerhand neu erfindet, indem er nun wirklich in jedem Sektor des Films Hand angelangt hat -, und da ist Abe, und beide stoßen eher durch Zufall auf eine schier unglaubliche Entdeckung: Mittels kleiner Boxen scheint es leblosen Gegenständen möglich zu sein, in der Zeit zu flanieren. Diese Boxen sind ursprünglich dafür vorgesehen, die Masse von Objekten zu reduzieren. Nur finden Aaron und Abe, was sie vor ihren Kollegen Robert und Philipp geheim halten, dass ihre Boxen mehr Elektrizität liefern als sie verbrauchen. Außerdem findet Abe Spuren eines seltsamen Gewächses in einer der Boxen. Im Labor stellt sich heraus: Es handelt sich um einen Pilz, der offenbar innerhalb weniger Tage ein Wachstum hingelegt hat, für das er unter normalen Umständen Jahre brauchen würde. Die Lösung des Rätsels, auf die zumindest ich nie gekommen wäre: Objekte, die in einer dieser Boxen platziert werden, zirkulieren in einer Art Endlosschleife zwischen zwei Punkten des Raum-Zeit-Kontinuums, die wiederum durch Einschalten und Ausschalten der jeweiligen Boxen gezielt gesetzt werden können. Bald schon nutzen unsere beiden Helden ihre Erfindung, inzwischen ausgedehnt auf Menschen-, d.h. Sarggröße, um sich am Börsenmarkt zu bereichern: Während Aaron und Abe A ihre Alltage bestreiten, haben sich Aaron und Abe B in einem Hotelzimmer verkrochen, um zu verhindern, dass sie mit ihren eigenen Doubles zusammentreffen, vor allem aber, um die Börsennachrichten zu verfolgen, und dieses Wissen dann, nachdem sie quasi in die Vergangenheit zurückgereist, und damit zu Aaron und Abe A geworden sind, gewinnbringend anzuwenden, auf das Vergangene anzuwenden, sobald dieses für sie wieder Gegenwart wurde. Wem diese Satz allein schon den Kopf schwirren lässt, der sollte sich PRIMER eher in kleinen Dosen zu Gemüte führen, denn, soviel immerhin ist gewiss: Was ich hier als rudimentäre Inhaltsangabe skizziere, das ist in etwa so, als würde man Dantes GÖTTLICHE KOMÖDIE zusammenfassen, indem man schreibt: Da ist jemand, der ein bisschen durch Himmel und Hölle spaziert.
Will sagen: Selten ist mir ein derart komplexer, labyrinthischer Film wie PRIMER untergekommen. Selbst nach der dritten Sichtung gerade eben komme ich einfach nicht hinterher, verwickle ich mich in meinen Notizen darüber, wann und wo welche Version von Aaron und von Abe einer anderen Version von Aaron und Abe wo und wann begegnet oder nicht begegnet, und bin ich auch sowieso irgendwann derart im Sog dieses Films verschwunden, dass ich sowieso nicht mehr klar denken kann. Leicht macht es einem Carruth, der nicht nur überzeugend schauspielern und hübsche minimalistische Piano-Sprengsel tupfen, sondern auch Drehbücher schreiben kann, deren Komplexität selbst David Lynch die Haare grauwerden lassen könnten, wenn sie das nicht längst wären, freilich nicht. PRIMER ist – nicht zuletzt seinem Budget geschuldet, für das bei einem Michael-Bay-Blockbuster nicht mal die Kaffee-Spesen gedeckt wären: dafür hat es sich Carruth aber immerhin nicht nehmen lassen, seinen Film nicht etwa digital, sondern auf 35mm zu drehen! – ein Kammerspiel, eine Art Zwei-Mann-Show, reduziert auf ein Minimum, sowohl in ästhetischer wie in technischer Hinsicht. Großartige Schauwerte sucht man in diesem Film vergebens. Das heißt nicht, dass PRIMER einen nicht mittels irritierender Bildkompositionen, seinem weichen, fließenden Schnitt, seiner bruchstückhaften Szenen-Anordnung bei der Stange halten würde. Ganz im Gegenteil: Nur ist der Film – der Prototyp einer Kopfgeburt von unglaublich talentierten, kreativen Nerds, die besessen von Gedankenexperimenten sind, für die neunundneunzig Prozent der Menschheit der hyperlogische Sachverstand fehlt – mit Haut und Haaren ein Underground-Produkt, gedreht mit Freunden und Freunden an freien Tagen für sage und schreibe siebentausend US-Dollar in insgesamt fünf Wochen. Krass ausgedrückt: Im Grunde sehen wir etwa achtzig Minuten lang zwei Männern dabei zu, wie sie sich in wechselnden Settings über wahnwitzige Themen miteinander unterhalten, und das oft in einer kryptischen Weise, die mehr Fragen aufwirft als beantwortet.
PRIMERs, wenn man so will – und ich will! -, Kauzigkeit offenbart sich nicht zuletzt darin, dass neben Aaron und Abe sämtliche Figuren zu Randnotizen werden. Erneut dem Budget geschuldet kann das sein, aber auch – aus der Not eine Tugend machend – ein raffinierter Schachzug, um den an sich schon komplizierten Film noch weiter zum Mysterium stilisieren. Dass Freundinnen, Ehefrauen und Kinder unserer Helden kaum Leinwandzeit bekomme, sei noch verziehen, doch selbst für den Verlauf der Handlung integrale Personen wie Abes und Aarons Forscherkollegen Robert und Philipp, Abes Schwiegervater in spe, ein gewisser Mr. Granger, der die Freunde ab einem bestimmten Punkt, als habe er ebenfalls Lunte bezüglich ihrer Zeitreisen gerochen, zu verfolgen beginnt, sowie Pattis, offenbar ein früherer potentieller Investor, von dem Aarons Faust andauernd die Obsession hegt, ihm endlich einmal die Fresse polieren zu können, oder der Ex-Freund von Abes Freundin in spe, der deren Geburtstagsparty mit einer Waffe stürmt, sind auf Schemen reduziert – oder tauchen gleich nur in den Dialogen auf, die die beiden Zeitreisepartner gerne und ausführlich führen, und bei denen man mehr Ohren spitzen müsste als man hat, um wirklich alle doppelten Böden dieses hypnotischen, zugleich völlig ereignislosen und zugleich eine ganze Welt beinhaltenden Films auszuhorchen. Es wundert mich gar nicht, dass Carruth zunächst Mathematik studiert, dann jahrelang als Ingenieur gearbeitet hat, bevor er sich entschloss, sich im Experimentalfilm eine Nische zu suchen, die selbst schon innerhalb einer ziemlich engen Nische verortet ist. PRIMER ist für mich genauso faszinierend wie eine Vorlesung Höherer Mathematik: Keinen Plan habe ich von den vielen Zahlen, Vektoren, griechischen Symbolen auf den Schiefertafeln, und dennoch strahlt ein irgendwie göttlicher Nimbus von ihnen aus – so, als könne man die gesamte Welt mit ihnen erklären, entschlüsseln, entfesseln.
Das Netz ist voll mit Handreichungen, akademischen Abhandlungen, Analysen zu PRIMER, für viele von denen ich wiederum ebenfalls eine Handreichung bräuchte, um sie zu verstehen. Das beweist nicht nur, was für eine harte Nuss der Film ist, sondern vielmehr, was für eine Faszination für einen bestimmten Publikumskreis offenbar von ihm ausgeht. Hierzu zähle ich, der bei der Erstsichtung nicht begeistert, aber auch nicht abgeneigt war -, und der ich wenige Tage später noch einmal zu dem Film zurückkehrte, freiwillig, aber auch halb unbewusst, einfach nur aus dem Antrieb heraus, ihm nun endlich auf die Schliche zu kommen, und zwar nicht so sehr inhaltlich – im Prinzip kann es mir ja egal sein, ob Aaron nun fünfzehnmal oder nur vierzehnmal in die Zukunft reist, wie viele Aarons wann im Film parallel zu einander existieren, und inwieweit das Handy, das er einmal versehentlich mit sich nimmt, statt es seinem Double in der Gegenwart zu lassen, wirklich üble Auswirkungen auf den Verlauf der Weltgeschichte hat -, sondern unter der Fragestellung: Wie kann ein Film, der, wie gesagt, eigentlich nur zwei zugegebenermaßen sympathische, jedoch auch nicht über Gebühr aufregende junge Männer beim Konversieren zeigt, jemanden ohne großartige naturwissenschaftliche Vorkenntnisse derart affizieren, dass er immer wieder, gedanklich oder auch physisch, auf ihn zurückkommt?
Eine Antwort habe ich noch nicht. Dafür eine These: PRIMER mit seinen fünf Wochen Drehzeit, seinem Budget von siebentausend Euro, seinem Hauptdarsteller, Drehbuchautor, Produzenten, Komponisten, Cutter in Personalunion ist einfach vorzüglich darin, die bekannte Alltagsrealität, obwohl oder gerade weil er nichts anderes abbildet als diese, derart auf den Kopf zu stellen, dass sie sich in ein spannendes, hirnfickendes, existenzialistisches Science-Fiction-Szenario verkehrt, von dessen Intensität Hollywood & Konsorten nicht mal zu träumen wagen. Schaut ihn euch an – und dann erklärt ihn mir!
Vor einigen Jahren, als ich mich vermehrt bei den Raumfahrtingenieuren einer gewissen mittelhochdeutschen Technischen Universität herumtrieb, löcherte ich einen der Leiter des Instituts für Raumfahrtforschung mit wohl für ihn ziemlich naiven Fragen. Ob ein Mensch, wenn er es denn nur wolle, hunderte von Jahre alt werden könne. Ob es sein könne, dass Außerirdische in Verkleidung bereits unter uns lebten. Natürlich auch, ob das möglich sei, in der Zeit herumzureisen. Seine Antwort war so präzise wie klug: Da das Universum sich, nach derzeitigem Stand der Forschung, permanent ausdehne, machten Zeitreisen überhaupt keinen Sinn, denn niemand wisse, wo er denn herauskommen würde, wenn er jetzt an einem Punkt A in eine Zeitmaschine steige, und mit ihr, sagen wir, bis zum Antiken Sparta reise, und dort an einem Punkt B ankomme, denn dieser Punkt B könne, aufgrund besagter Expansion aller Materie, irgendwo im Nichts liegen, im luftleeren Raum, im Kosmos. Auch kürzere Distanzen seien bereits eine Schwierigkeit: Woher weiß ich denn, wenn ich heute in diesem Park hier in eine Zeitmaschine steige, und mich fünfzig Jahre in die Vergangenheit katapultiere, dass genau auf derselben Stelle damals nicht ein Baum gestanden hat? Im Grunde müsste ich meine Maschine an einem Ort aufstellen, der völlig meiner Kontrolle unterworfen ist, und von dem ich genau weiß, dass sich nur dann in ihm etwas verändert, wenn diese Veränderung von mir selbst ausgeht. Aber sowieso, sagte er, sei das mit Zeitmaschinen reine Phantasterei. Wenn überhaupt, könnte mir ein Schwarzes Loch bei der Überwindung räumlich-zeitlicher Grenzen helfen, doch bis ich bis zum Epizentrum eines solchen hingelangt sei, wäre ich, würde ich heute von der Erde aus mit einem Raumschiff starten, schon längst verstorben.
In PRIMER funktioniert es allerdings. Das mit den Zeitmaschinen – es sind Boxen, deren Funktionsweisen ich beim besten Willen nicht begriffen habe -, und das mit den Zeitreisen – auch wenn ich wohl noch ein Jahr mich mit diesem kleinen, wundervollen Film beschäftigen muss, um zu begreifen, wie viele genau die Protagonisten denn nun unternehmen, und wie viele Duplikate ihrer selbst deshalb irgendwo in der filmischen Diegese herumlaufen. Dabei ist die Handlung, runtergebrochen aufs Basalste, schon fast schlicht: Da ist Aaron – gespielt von Regisseur, Drehbuchautor, Produzent, Cutter, Filmkomponist Shane Carruth, der den Terminus der Personalunion kurzerhand neu erfindet, indem er nun wirklich in jedem Sektor des Films Hand angelangt hat -, und da ist Abe, und beide stoßen eher durch Zufall auf eine schier unglaubliche Entdeckung: Mittels kleiner Boxen scheint es leblosen Gegenständen möglich zu sein, in der Zeit zu flanieren. Diese Boxen sind ursprünglich dafür vorgesehen, die Masse von Objekten zu reduzieren. Nur finden Aaron und Abe, was sie vor ihren Kollegen Robert und Philipp geheim halten, dass ihre Boxen mehr Elektrizität liefern als sie verbrauchen. Außerdem findet Abe Spuren eines seltsamen Gewächses in einer der Boxen. Im Labor stellt sich heraus: Es handelt sich um einen Pilz, der offenbar innerhalb weniger Tage ein Wachstum hingelegt hat, für das er unter normalen Umständen Jahre brauchen würde. Die Lösung des Rätsels, auf die zumindest ich nie gekommen wäre: Objekte, die in einer dieser Boxen platziert werden, zirkulieren in einer Art Endlosschleife zwischen zwei Punkten des Raum-Zeit-Kontinuums, die wiederum durch Einschalten und Ausschalten der jeweiligen Boxen gezielt gesetzt werden können. Bald schon nutzen unsere beiden Helden ihre Erfindung, inzwischen ausgedehnt auf Menschen-, d.h. Sarggröße, um sich am Börsenmarkt zu bereichern: Während Aaron und Abe A ihre Alltage bestreiten, haben sich Aaron und Abe B in einem Hotelzimmer verkrochen, um zu verhindern, dass sie mit ihren eigenen Doubles zusammentreffen, vor allem aber, um die Börsennachrichten zu verfolgen, und dieses Wissen dann, nachdem sie quasi in die Vergangenheit zurückgereist, und damit zu Aaron und Abe A geworden sind, gewinnbringend anzuwenden, auf das Vergangene anzuwenden, sobald dieses für sie wieder Gegenwart wurde. Wem diese Satz allein schon den Kopf schwirren lässt, der sollte sich PRIMER eher in kleinen Dosen zu Gemüte führen, denn, soviel immerhin ist gewiss: Was ich hier als rudimentäre Inhaltsangabe skizziere, das ist in etwa so, als würde man Dantes GÖTTLICHE KOMÖDIE zusammenfassen, indem man schreibt: Da ist jemand, der ein bisschen durch Himmel und Hölle spaziert.
Will sagen: Selten ist mir ein derart komplexer, labyrinthischer Film wie PRIMER untergekommen. Selbst nach der dritten Sichtung gerade eben komme ich einfach nicht hinterher, verwickle ich mich in meinen Notizen darüber, wann und wo welche Version von Aaron und von Abe einer anderen Version von Aaron und Abe wo und wann begegnet oder nicht begegnet, und bin ich auch sowieso irgendwann derart im Sog dieses Films verschwunden, dass ich sowieso nicht mehr klar denken kann. Leicht macht es einem Carruth, der nicht nur überzeugend schauspielern und hübsche minimalistische Piano-Sprengsel tupfen, sondern auch Drehbücher schreiben kann, deren Komplexität selbst David Lynch die Haare grauwerden lassen könnten, wenn sie das nicht längst wären, freilich nicht. PRIMER ist – nicht zuletzt seinem Budget geschuldet, für das bei einem Michael-Bay-Blockbuster nicht mal die Kaffee-Spesen gedeckt wären: dafür hat es sich Carruth aber immerhin nicht nehmen lassen, seinen Film nicht etwa digital, sondern auf 35mm zu drehen! – ein Kammerspiel, eine Art Zwei-Mann-Show, reduziert auf ein Minimum, sowohl in ästhetischer wie in technischer Hinsicht. Großartige Schauwerte sucht man in diesem Film vergebens. Das heißt nicht, dass PRIMER einen nicht mittels irritierender Bildkompositionen, seinem weichen, fließenden Schnitt, seiner bruchstückhaften Szenen-Anordnung bei der Stange halten würde. Ganz im Gegenteil: Nur ist der Film – der Prototyp einer Kopfgeburt von unglaublich talentierten, kreativen Nerds, die besessen von Gedankenexperimenten sind, für die neunundneunzig Prozent der Menschheit der hyperlogische Sachverstand fehlt – mit Haut und Haaren ein Underground-Produkt, gedreht mit Freunden und Freunden an freien Tagen für sage und schreibe siebentausend US-Dollar in insgesamt fünf Wochen. Krass ausgedrückt: Im Grunde sehen wir etwa achtzig Minuten lang zwei Männern dabei zu, wie sie sich in wechselnden Settings über wahnwitzige Themen miteinander unterhalten, und das oft in einer kryptischen Weise, die mehr Fragen aufwirft als beantwortet.
PRIMERs, wenn man so will – und ich will! -, Kauzigkeit offenbart sich nicht zuletzt darin, dass neben Aaron und Abe sämtliche Figuren zu Randnotizen werden. Erneut dem Budget geschuldet kann das sein, aber auch – aus der Not eine Tugend machend – ein raffinierter Schachzug, um den an sich schon komplizierten Film noch weiter zum Mysterium stilisieren. Dass Freundinnen, Ehefrauen und Kinder unserer Helden kaum Leinwandzeit bekomme, sei noch verziehen, doch selbst für den Verlauf der Handlung integrale Personen wie Abes und Aarons Forscherkollegen Robert und Philipp, Abes Schwiegervater in spe, ein gewisser Mr. Granger, der die Freunde ab einem bestimmten Punkt, als habe er ebenfalls Lunte bezüglich ihrer Zeitreisen gerochen, zu verfolgen beginnt, sowie Pattis, offenbar ein früherer potentieller Investor, von dem Aarons Faust andauernd die Obsession hegt, ihm endlich einmal die Fresse polieren zu können, oder der Ex-Freund von Abes Freundin in spe, der deren Geburtstagsparty mit einer Waffe stürmt, sind auf Schemen reduziert – oder tauchen gleich nur in den Dialogen auf, die die beiden Zeitreisepartner gerne und ausführlich führen, und bei denen man mehr Ohren spitzen müsste als man hat, um wirklich alle doppelten Böden dieses hypnotischen, zugleich völlig ereignislosen und zugleich eine ganze Welt beinhaltenden Films auszuhorchen. Es wundert mich gar nicht, dass Carruth zunächst Mathematik studiert, dann jahrelang als Ingenieur gearbeitet hat, bevor er sich entschloss, sich im Experimentalfilm eine Nische zu suchen, die selbst schon innerhalb einer ziemlich engen Nische verortet ist. PRIMER ist für mich genauso faszinierend wie eine Vorlesung Höherer Mathematik: Keinen Plan habe ich von den vielen Zahlen, Vektoren, griechischen Symbolen auf den Schiefertafeln, und dennoch strahlt ein irgendwie göttlicher Nimbus von ihnen aus – so, als könne man die gesamte Welt mit ihnen erklären, entschlüsseln, entfesseln.
Das Netz ist voll mit Handreichungen, akademischen Abhandlungen, Analysen zu PRIMER, für viele von denen ich wiederum ebenfalls eine Handreichung bräuchte, um sie zu verstehen. Das beweist nicht nur, was für eine harte Nuss der Film ist, sondern vielmehr, was für eine Faszination für einen bestimmten Publikumskreis offenbar von ihm ausgeht. Hierzu zähle ich, der bei der Erstsichtung nicht begeistert, aber auch nicht abgeneigt war -, und der ich wenige Tage später noch einmal zu dem Film zurückkehrte, freiwillig, aber auch halb unbewusst, einfach nur aus dem Antrieb heraus, ihm nun endlich auf die Schliche zu kommen, und zwar nicht so sehr inhaltlich – im Prinzip kann es mir ja egal sein, ob Aaron nun fünfzehnmal oder nur vierzehnmal in die Zukunft reist, wie viele Aarons wann im Film parallel zu einander existieren, und inwieweit das Handy, das er einmal versehentlich mit sich nimmt, statt es seinem Double in der Gegenwart zu lassen, wirklich üble Auswirkungen auf den Verlauf der Weltgeschichte hat -, sondern unter der Fragestellung: Wie kann ein Film, der, wie gesagt, eigentlich nur zwei zugegebenermaßen sympathische, jedoch auch nicht über Gebühr aufregende junge Männer beim Konversieren zeigt, jemanden ohne großartige naturwissenschaftliche Vorkenntnisse derart affizieren, dass er immer wieder, gedanklich oder auch physisch, auf ihn zurückkommt?
Eine Antwort habe ich noch nicht. Dafür eine These: PRIMER mit seinen fünf Wochen Drehzeit, seinem Budget von siebentausend Euro, seinem Hauptdarsteller, Drehbuchautor, Produzenten, Komponisten, Cutter in Personalunion ist einfach vorzüglich darin, die bekannte Alltagsrealität, obwohl oder gerade weil er nichts anderes abbildet als diese, derart auf den Kopf zu stellen, dass sie sich in ein spannendes, hirnfickendes, existenzialistisches Science-Fiction-Szenario verkehrt, von dessen Intensität Hollywood & Konsorten nicht mal zu träumen wagen. Schaut ihn euch an – und dann erklärt ihn mir!