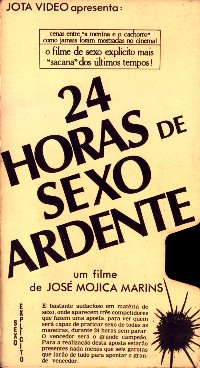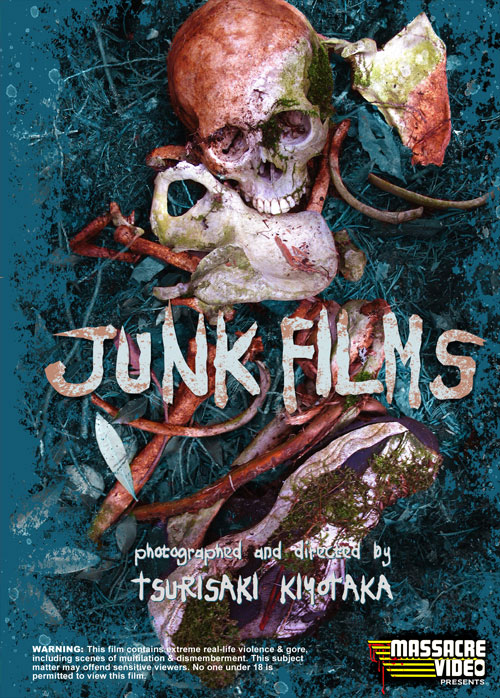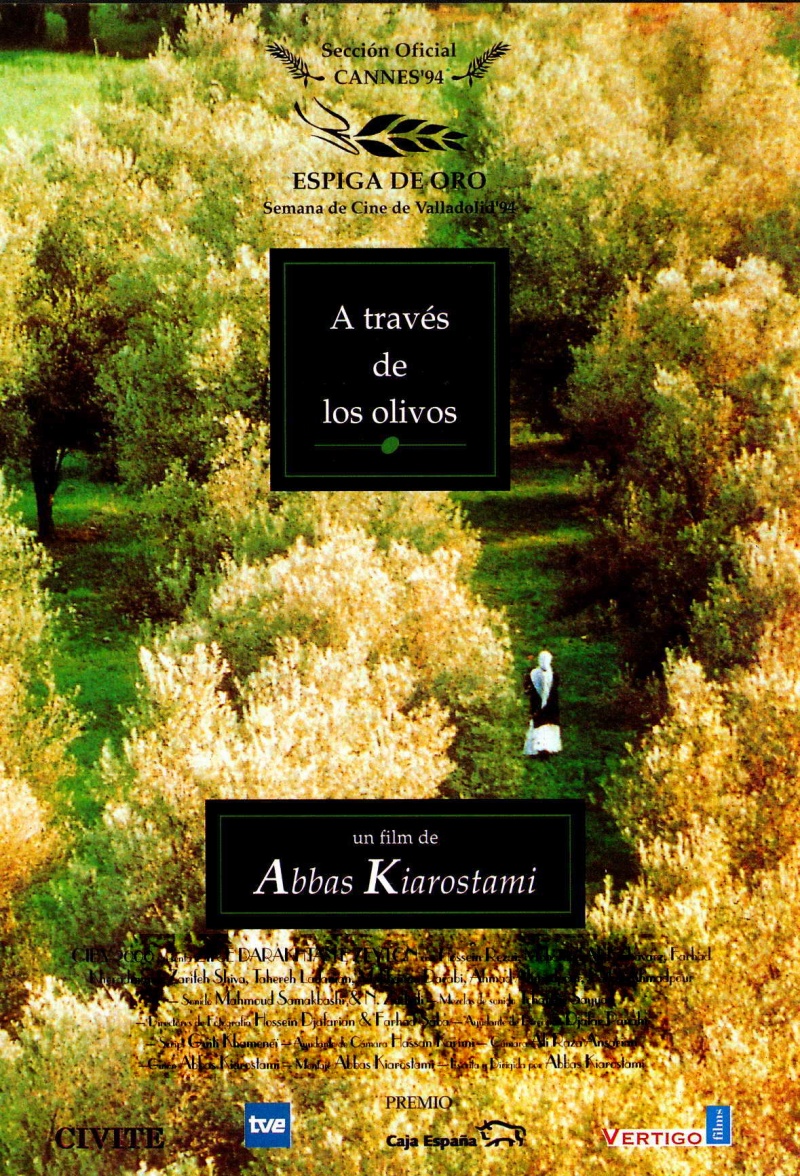Re: Salvatores Skizzen zu einer Studie der absoluten Kontingenz
Verfasst: Mi 18. Jul 2018, 12:37

Originaltitel: 5 tombe per un medium
Produktionsland: Italien/USA 1966
Regie: Massimo Pupillo
Darsteller: Barbara Steele, Walter Brandi, Mirella Maravidi, Alfredo Rizzo, Riccardo Garrone
Was habt ihr nur immer mit euren Poe-Referenzen, liebe europäischen und überseeischen Gothic-Horror-Produktionen der 1960er Jahre, die ihr mir zwar als vollmundige Versprechen in Vor- und Abspännen aufs Brot schmiert, letztendlich aber doch so gut wie niemals wirklich einlöst? Ihr könnte mich nämlich nicht hinters Licht führen. Ich habe von dem US-amerikanischen Schriftsteller, dessen Werk beispiellos Rückstände schauerromantischer Trivialliteratur mit genuin modernen und teilweise nahezu avantgardistischen Ansätzen vereint, nun wirklich alles gelesen – seien es seine Gedichte, seine essayistischen Texte, seinen einzigen unvollendeten Roman, natürlich seine populären Kurzgeschichten, die den Grundstein für psychologisch motivierten literarischen Horror legten -, und meistens finde ich dort, wo Poe draufsteht, höchstens das eine oder andere versprengte Motiv, einen vertrauten Namen, eine einzige Idee unter vielen, die tatsächlich von ihm stammt oder zumindest von seinen Ideen inspiriert worden ist, oftmals aber auch rein gar nichts, was dieses Schmücken mit fremden Federn rechtfertigen würde. 5 TOMBE PER UN MEDIUM ist auch so ein Fall. Poe soll hier eine nicht näher definierte Vorlage beigesteuert haben. Es gibt allerdings keine Erzählung von ihm, die auf den Titel des Films, oder einen ähnlichen, hört, und auch sonst muss man die Kongruenzen, die zwischen Poes Oeuvre und vorliegender US-amerikanisch/italienischen Co-Produktion unter der Regie Massimo Pupillos, (der allerdings mit dem Endergebnis derart unzufrieden gewesen sein soll, dass er seinen Namen in den Credits freiwillig räumte, damit dieser durch den des Produzenten Ralph Zucker ersetzt werden konnten), in äußerst losen Parallelen suchen wie, dass Poe und Pupillo beide von Menschen, Pferden, alten Gemäuern erzählen. In den zeitgleich entstandenen AIP-Filmen von Roger Corman stolpert man immerhin noch über den einen oder anderen bekannten Handlungsstrang, und in Antonio Margheritis DANZA MACABRA von 1964 tritt Poe immerhin noch höchstselbst in Erscheinung, aber 5 TOMBE PER UN MEDIUM ist ein vollständig eigenständiger Film, der – das sei an dieser Stelle schon einmal mit Nachdruck betont – solcherlei Publikumstäuschung gar nicht nötig hätte, denn: Was für ein wunderschönes, wagemutiges, wildes Werk, das gleich drei meiner liebsten B-Movie-Genres in einer abenteuerlichen Mixtur verrührt: Klassischen Gothic Horror mit Schuhu und Donnerschlag und Türknarzen und viel Trockeneisnebel; klassischen Whodunit-Krimi mit einer Kiste voller roter Heringe und einer Halle voller undurchsichtiger, unsympathischer, unheimlicher potentieller Verdächtiger; klassischen Zombiefilm, bei dem sich die jahrhundertelang verschlossenen Grabdeckel von Individuen, die noch in ihren Särgen besinnungslos vor Rache kreischen, langsam heben, um die Gegenwart mit einer blutdürstigen Vergangenheit zu überschwemmen.

Abb.1: Würde ich jemals ein Buch über den (italienischen) Gothic-Horrorfilm der 1960er Jahre schreiben, würde ich es "Eine Eule im Getriebe" nennen, und als Cover sollte diese Szenen aus vorliegendem Film dienen, die ich dann auch im Ersten Kapitel ausführlich sezieren würde, um auf die immanente Genre-Dichotomie zwischen Tradition (Eule) und Moderne (Automotor) hinzuweisen, und ich würde neben ihr Goyas Gemälde EL SUENO DE LA RAZÓN PRODUCE MONSTRUOS mit seinen Eulen und Fledermäusen abdrucken lassen, und argumentieren, dass "sueño" im Spanischen sowohl "Traum" als auch "Schlaf" bedeuten kann, und mich fragen: Muss die Vernunft nur einpennen, und dann kommen all die Schreckgespenster, oder träumt die schlafende Vernunft sie am Ende gar herbei?, und so weiter.
Bei der Prologsequenz muss ich an den kleinen Hans denken. Der hieß eigentlich Herbert Graf, und befand sich bei Sigmund Freud in Behandlung, der ihm 1909 seine detailreichste Fallstudie widmet: ANALYSE DER PHOBIE EINES FÜNFJÄHRIGEN KNABEN. Was stimmte nicht mit dem Knaben, dass seine Eltern ihn zum Begründer der Psychoanalyse auf die Couch schickten? Mit viereinhalb wurde er Zeuge eines Verkehrsunfalls. Ein Pferdewagen stürzt auf offener Straße, und mit ihm das ihn ziehende Ross. Seitdem ist Hänschen merklich verstört. Er hat Angst vor Pferden, vor Pelikanen und vor dem Pipi-Machen. Für Freud steht fest: Nur dem Ödipus-Komplex kann die Schuld hierfür in die Schuhe geschoben werden. Die Pferde seien natürlich ein Phallussymbol, und außerdem habe Hans kurz zuvor ein Schwesterchen bekommen, weswegen sämtliche Vorgänge, die mit der Fortpflanzung zu tun haben, ihn in panischen Schrecken versetzen, und er habe mehrmals onaniert, und sein Vater ihm das verboten. Während Freud in heute selbst von psychoanalytischen Hardlinern mindestens kritisch betrachtenden Argumentationslinien seine Theorie zu belegen versucht, Kastrationsängste und Penisneid seien die grundlegenden Pfeiler der menschlichen Kultur, eröffnet er quasi nebenbei, und ohne es zu wollen, erschütternde Einblicke in eine relativ lieblos verlaufende Kindheit um Neunzehnhundert, in der ein Kind nicht zur Projektionsfläche für wissenschaftliche Theorien wird, sondern zudem unter väterlichen Drohungen, mütterlichem Liebesentzug und darunter leidet, dass ein Pferdchen vor seinen Augen verunglückt ist – und wahrscheinlich weniger an uneingestandenen vatermördischen Absichten, oder uneingestandenen inzestuösen Gefühlen der Mutti gegenüber. Wozu dieser Exkurs ins Wien des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, wo wir doch eigentlich im Italien des Jahres 1964 sind? Weil die Prologsequenz von 5 TOMBE PER UN MEDIIM sich als ein atemloser Kurzfilm präsentiert, der die wichtigsten Freud’schen Symbole zu einem dichten Gewebe zusammenschnürt. Der kleine Hans ist groß, und trinkt zitternd und schweißgebadet ein Glas Hochprozentiges in Großaufnahme. Das Quietschen eines Pferdekarrens ist zu hören, Hufgetrappel. Zoom auf eine Glastür, wo ein Arm ihre Außenseite begrabscht. Flucht des Mannes aus einer verlassenen Schenke in einen Traum für jeden Freund gepflegter Schwarzweißphotographie. Die Kamera folgt ihm in einem anmutigen Schwenk, während er durch verlassene Dorfgassen eilt, und schließlich in einem Pferdestall landet, wo er sein Reittier satteln und die Flucht auf vier Beinen fortsetzen möchte. Soweit kommt es nicht: Von der Tonspur dröhnt und trommelt es. Kein Wunder, dass sein Gaul durchdreht und die Hufe spielen lässt. Das Ende des Lieds: Unser Held liegt mit zerschmettertem Schädel – ein Auge guckt vorwurfsvoll aus dem Matsch seines Kopfes in die heranzoomende Kamera – im Heu, und der Titel des Films kann erscheinen. Kann man schöner darstellen, dass ein vor der imaginären Entmannungsschere Fliehender letztlich von einem Penis, der größer ist als der seine, den eigenen amputiert bekommt als in diesem Ensemble aus animalischer, ophthalmischer und konkret-physischer Schwanz-Surrogate? Noch schöner: Pupillos Interpretation ödipaler Triebregungen findet nicht in einer sterilen Seelenklempnerpraxis stattfindet, sondern inmitten der üppigsten Auswüchse des gotischen Grusels.

Abb.2: Die Kräfteverhältnisse sind natürlich klar abgemessen. Winzig erscheint Alberts Automobil im Vergleich zu den Säulenstempeln, die das Schloss von Bregonville bewachen. So nützlich das technische Vehikel auch ist, so wenig Chancen hat es gegen die rein ornamentale Natur der Vergangenheit. Nach einem Schwenk sehen wir übrigens gleich das Hauff-Anwesen, auf das das Auto zufährt, und erneut vor seiner historischen Größe klein wird wie eine Fliege.
Die bürokratische, durchrationalisierte, mit Paragraphen und harten Fakten operierende Moderne ist indes nur einen Schnitt entfernt: Wir wechseln in eine Rechtsanwaltskanzlei, wo gerade einer der beiden Notare, Joseph Morgan, seinen Hut genommen hat, um übers Wochenende zu einem wichtigen Termin zu eilen, und sein Kollege Albert Kovac deshalb statt seiner einen offenbar dringlichen Brief entgegennimmt, in dem ein sterbender Schlossbesitzer namens Hauff um die Anwesenheit eines Rechtsgelehrten bei dem Aufsetzen seines Testaments bittet. Zwar wundern sich Kovac und Sekretärin ein bisschen über die Handschrift des Verfassers, denn „so schreibe seit Jahrhunderten niemand mehr“, doch natürlich kann man, wie Kovac anmerkt, einem Totgeweihten selbst am Vorabend des Wochenendes seinen letzten Wunsch nicht abschlagen, und schon tritt der nominelle Held unseres Schauerstücks eine Reise an, die ihn in eins jener Paralleluniversum bringt, wie wir es auch aus vergleichsweise Hammer-Produktionen kennen: Da gibt es Leute mit Nachnamen wie Nemek, Stinner oder eben Hauff, und Ortschaften namens Kravitz, Ratzen oder Bregonville, und über manchen Läden sind deren Funktionsbezeichnungen – wie bei einer „Apotheke“ – in Deutsch angegeben. Das ist natürlich eine Verbeugung an die Genre-Tradition. Schon Poe wusste, dass der Schrecken aus Deutschland kommt, und spielt damit auf den immensen Ausstoß trivial-unterhaltsamer Geistergeschichten, Raubritterromane und Räuberpistolen aus deutschsprachigen Ländern Ende um Achtzehnhundert an. Seine erste veröffentlichte short story von 1836 heißt dementsprechend auch noch METZENGERSTEIN, Untertitel: A TALE IN THE TRADITON OF THE GERMAN, und spielt in einem pseudo-mittelalterlichen Phantasie-Ungarn, und ja, auch ein grusliger Gaul hat eine tragende Rolle in ihr inne. Während es nicht viel Sinn macht, der Topographie des Films mit geographischen Kenntnissen auf die Pelle zu rücken, lässt sich exakt indes seine temporale Verortung bestimmen: Wir befinden uns im Frühjahr 1911 – um genau zu sein: im Mai –, denn, wie Kovac erfährt, als er endlich im Schloss von Bregonville ankommt, hat dessen Besitzer bereits vor einem Jahr das Zeitliche gesegnet, während seine Erben – Töchterchen Corinne, die natürlich sofort ein Auge nach Albert wirft, der dieses geschickt aus der Luft zu fangen weiß, sowie Stiefmutter Cleo, die derart unterkühlt und fahl daherkommt, dass der Heizboiler Überstunden leisten muss – sich nicht erklären, wer denn in seinem Namen einen solchen Brief geschickt haben soll: Ist ein makabrer Scherz, eine Verwechslung, eine Notiz aus dem Jenseits? Immerhin ähneln Schrift und Siegel denen des Verstorbenen wie ein Ei dem anderen. Klar, Albert verbringt die Nacht im Schloss, und erfährt dessen Geschichte von der aufmerksamen Corinne: Errichtet sei es auf einem Lazarett des fünfzehnten Jahrhunderts, in dem Pestkranke untergebracht worden sind. Einige von ihnen seien losgezogen, um die Bewohner der umliegenden Dörfer mit ihrer tödlichen Krankheit zu infizieren. Ihre zur Strafe dafür abgehackten Hände kann man noch in Vitrinen im Arbeitszimmer ihres toten Papas bestaunen, und die Gräber der Unglückseligen hinterm Schloss auf dem Acker. Ob Hauff ein ernstzunehmender Forscher gewesen sei, oder nur jemand, der es liebte, seine Besucher zu erschrecken, fragt sich der zunehmend irritierte Albert nicht nur angesichts der wie selbstverständlich ausgestellten Totenhände, sondern auch des Faktotums Kurt, seinerzeit Hauffs buckliger Bediensteter, der immer noch stumm durch die Gemächer schleicht.

Abb.3: Ein Kamera-Zoom in die Vergangenheit: So sah das Gelände des Hauff-Anwesens früher aus, als da noch ein Siechenlazarett stand, in dem die Pest wütete. Überall in diesem Gemäuer tun sich solche Schlüssellochblicke auf - am Ende ganz leiblich, wenn sich Sargdeckel heben und konservierte Hände zu Wuseln anfangen.
Etwas unterscheidet 5 TOMBE PER UN MEDIUM von ähnlich gelagerten Filmen der italienischen Massenproduktion gotischen Grusels – und das kann man ihm dann doch, mit einigem Biegen und Brechen, als kleine Reminiszenz an die Spezifik von Poes Oeuvre anrechnen. Poe operiert, wie gesagt, mit einem Teil seines literarischen Bestecks im traditionellen Repertoire der Schauerromantik, und mit dem andern in einem rein psychologischen Grauen, das sich aus menschlichen Extremsituationen wie Folter, Wahnsinn oder sexuellen Obsessionen speist. Da gibt es hübsche Frauenleichen, die sich als Scheintote entpuppen, und an traurigen Seen liegende Herrschaftshäuser, und vatikanische Verließe im Zwielicht schlotternder Funzeln, wie man das aus Standardwerken der Gothic Novel von Ann Radcliffe oder Clara Reeve oder Horace Walpole kennt. Da gibt es auch die langsam anschwellende Manie, einen eigentlich harmlosen Menschen zu ermorden, eine Fixation auf die Zähne eines jungen Mädchens, oder mesmeristische Experimente, die ein Leben nach dem Tod ermöglichen sollen. 5 TOMBE PER UN MEDIUM ist ein Film, der diese beiden widerstreitenden Pole direkt an seiner Fassade aushandelt. Schon der Pferdchentraum zu Beginn, indem einfach mal psychoanalytische Theoretisieren im Gewand wohligen Schauders daherkommt, sowie die Wahl des Jahres 1911 deutet auf eine den Film strukturierende Hybris hin: Albert reist nicht mit der obligatorischen Kutsche ins Hinterland, sondern mit seinem Privatwagen. Der tote Hauff hat eine Wachswalze voll Tonaufzeichnungen hinterlassen, wo er, wie Van Helsing in Bram Stokers DRACULA, seine Forschungsergebnisse bezüglich der Siechenvergangenheit des eigenen Schlösschens zum Besten gibt, und, nebenbei, seinerzeit moderne Technik unserem Helden Albert, metaphysischem Grauen auf den Leib rücken. Zugleich aber ist Bregonville ein Ort, der beinahe in seiner morbiden Vergangenheit ersäuft, voller Gemälde, Statuetten und sonstiger Artefakte, die so tun, als sei die Zeit gemeinsam mit ihnen erstarrt. Wunderschön bringt die Szene, die erklären soll, weshalb Albert am nächsten Morgen nicht zurück ins Büro gelangt, sowohl die Diskrepanzen zwischen Progression und Tradition auf den Punkt, sondern führt sie außerdem auf wirklich aberwitzige Weise zusammen. Zwiespältig steht das Hausmädchen der Hauffs Alberts Auto gegenüber. Sie sagt, ihr Großvater habe sie immer vor den Dingern gewarnt. Trotzdem ist sie neugierig: Fährt das denn dann von selbst? Albert kurbelt derweil, um den Motor in Bereitschaft zu versetzen. Da dringt ein Geräusch unter der Haube hervor, als ob man einer Katze auf den Schwanz getreten hätte. Als er einen Blick ins Innere des Fahrzeugs wirft, stellt er fest, dass sich eine Eule im Getriebe verfangen hat. An eine Weiterfahrt ist nicht zu denken. Der regelrecht zerfledderte Vogel verklebt und verkeilt den Motor. Es ist ein Angriff der vergangenen auf die gegenwärtige Zeit, so, als sei der Nachtvogel aus dem berühmten Goya-Gemälde vom Schlaf/Traum der Vernunft herbeigeflattert, um das Herandrängen der technologische Moderne in die Einöde von Bregonville durch den Einsatz des eigenen Lebens vernichtend zurückzuschlagen. Albert jedenfalls bleibt nichts übrig, als erst einmal vor Ort zu bleiben, sich in Corinne zu verknallen, zusammen mit dem Dorfarzt Dr. Nemek dem Rätsel um einen briefeschreibenden Verstorbenen nachzugehen, und sich alsbald dem noch größeren Rätsel gegenüberzusehen, dass alle fünf Zeugen, die den Tod Hauffs miterlebt haben – er soll sturzbesoffen eine Treppe runtergestürzt sein – entweder bereits innerhalb eines Jahres von Herzlähmung dahingerafft worden sind, oder ihnen jetzt vor den Augen wegsterben: Den Bürgemeister Berit beispielweise finden sie zusammen leblos in der Apotheke, und kurz darauf knüpft sich Zeuge Nummer vier, der paralysierte Stinner, in seiner Stube auf. Nur der fünfte Mann fehlt noch? Wer er ist, weiß niemand, da sein Name auf dem Totenschein unleserlich ist…

Abb.4: Weshalb sich eine Reminiszenz an Carl Theodor Dreyers VAMPYR entgehen lassen, wenn man die Gelegenheit dazu hat? Nachdem sich der paralysierte Stinner aufgeknüpft hat, schneidet ihn ein Polizeibeamter vom Deckenbalken, und tritt dabei zunächst einzig als körperloser Schatten in Erscheinung.
5 TOMBE PER UN MEDIUM ist kein oberflächlicher Film. Seiner Struktur selbst werden immanent die Dispositive der Umbruchszeit eingeschrieben, in der er spielt. Wie ein hard-boiled Privatermittler irgendeines film noir erläutert Albert mit einer zugleich reflektierten wie coolen Stimme uns immer mal wieder seine Gedanken und Gefühle. Nachdem erstmal das Arsenal an gänsehauterzeugenden Kulissen und Charakteren etabliert worden ist, kippt der Film in eine Krimihandlung, bei der es erst um Deduktion und Feinanalyse geht, und dann darum, den Cast in zwei Gruppen einzuteilen: Die strahlenden Helden aus dem Bilderbuch, und die ganz Verworfenen, an denen Mario Bava seine Freude gehabt hätte. Manche Szene kommt mir daher wie aus einem Experimentalfilm. Wie göttlich einfach nur, wie das Hausmädchen der Hauffs durch einen Wald stapft, und dazu ein Knarren ertönt, als würden wir, wie in Ingmar Bergmans PERSONA, gleich dem Film selbst beim Rollen und vielleicht zuhören. Wie zum Sich-Darin-Suhlen einladend einfach nur die Schwarzweißphotographie von Carlo di Palma, der genau weiß, wann welcher Schatten welchen lichten Fleck verschlucken muss, und wann in welchem Meer aus Schwarz wo ein heller Punkt auflodern soll. Wie rhythmisch die Montage, wenn sie immer mal wieder die narrative Dynamik für ein paar Sekunden zum Verweilen animiert, und sich zusammen mit einem überlauten Tonspur-Ticken ganz darin gefällt, Großaufnahmen von sich in Gang setzenden Uhren aneinanderzuheften. Wie nett auch, Luciano Piggozi als Diener Kurt zu sehen, und Barbara Steele als unnahbare femme fatale, und Walter Brandi als Schwiegermutters Liebling. Nicht zuletzt: Was für einen Teufel mag die insgesamt vier Drehbuchautoren geritten haben, den Film – statt ihn einer logisch nachvollziehbaren Auflösung entgegenzuführen – in der letzten Viertelstunde dann noch einer surrealistischen Invasion an Eigenheiten zu opfern, bei der die ausgestopften Pestkrankenhände das Grapschen beginnen, ein kleiner Junge plötzlich mitternächtlich trällernd an einem Brunnen erscheint, und nur reinigendes Wasser Protagonisten und Antagonisten davor bewahren kann, vorm plötzlich um sich greifenden und in Sekundenschnelle mordenden Schwarzen Tod gerettet zu werden. Verstanden habe ich zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr, was da eigentlich gerade vor meiner Nase passiert. Klar ist nur: Auch wenn das Getriebe noch etwas weitergetuckert hat, es sind zu viele Eulen, viel zu viele, als dass sich aus seinem Gestotter noch etwas Sinnloses herauslesen ließe. Bei der großflächigen Kontamination der Physik durch die Metaphysik bleiben letztendlich keine Zweifel daran, für wen oder diese kleine, schmucke, und unverständlicherweise von mir jetzt erst entdeckte bunte Tüte betörender Bilder Partei ergreift. Auch Pupillo, der Mitte der 60er einen Lauf gehabt zu haben scheint, und die Welt 1965 nicht nur mit 5 TOMBE PER UN MEDIUM, sondern noch mit zwei weiteren Gothic-Horror-Stücken - LA VENDETTI DI LADY MORGAN sowie IL BOIA SCARLATTO – zu einem besseren Ort gemacht hat, gehört allein angesichts vorliegenden Films nun wirklich nicht mit dem Gesicht zur Wand in die Trash-Ecke, sondern in jenen so schwierig fassbaren Grauzonenbereich zwischen Avantgarde-Sensibilitäten, Erzählkino und Lust am Trivialen, an der ich mich nicht sattsehen kann.

Abb.1: Würde ich jemals ein Buch über den (italienischen) Gothic-Horrorfilm der 1960er Jahre schreiben, würde ich es "Eine Eule im Getriebe" nennen, und als Cover sollte diese Szenen aus vorliegendem Film dienen, die ich dann auch im Ersten Kapitel ausführlich sezieren würde, um auf die immanente Genre-Dichotomie zwischen Tradition (Eule) und Moderne (Automotor) hinzuweisen, und ich würde neben ihr Goyas Gemälde EL SUENO DE LA RAZÓN PRODUCE MONSTRUOS mit seinen Eulen und Fledermäusen abdrucken lassen, und argumentieren, dass "sueño" im Spanischen sowohl "Traum" als auch "Schlaf" bedeuten kann, und mich fragen: Muss die Vernunft nur einpennen, und dann kommen all die Schreckgespenster, oder träumt die schlafende Vernunft sie am Ende gar herbei?, und so weiter.
Bei der Prologsequenz muss ich an den kleinen Hans denken. Der hieß eigentlich Herbert Graf, und befand sich bei Sigmund Freud in Behandlung, der ihm 1909 seine detailreichste Fallstudie widmet: ANALYSE DER PHOBIE EINES FÜNFJÄHRIGEN KNABEN. Was stimmte nicht mit dem Knaben, dass seine Eltern ihn zum Begründer der Psychoanalyse auf die Couch schickten? Mit viereinhalb wurde er Zeuge eines Verkehrsunfalls. Ein Pferdewagen stürzt auf offener Straße, und mit ihm das ihn ziehende Ross. Seitdem ist Hänschen merklich verstört. Er hat Angst vor Pferden, vor Pelikanen und vor dem Pipi-Machen. Für Freud steht fest: Nur dem Ödipus-Komplex kann die Schuld hierfür in die Schuhe geschoben werden. Die Pferde seien natürlich ein Phallussymbol, und außerdem habe Hans kurz zuvor ein Schwesterchen bekommen, weswegen sämtliche Vorgänge, die mit der Fortpflanzung zu tun haben, ihn in panischen Schrecken versetzen, und er habe mehrmals onaniert, und sein Vater ihm das verboten. Während Freud in heute selbst von psychoanalytischen Hardlinern mindestens kritisch betrachtenden Argumentationslinien seine Theorie zu belegen versucht, Kastrationsängste und Penisneid seien die grundlegenden Pfeiler der menschlichen Kultur, eröffnet er quasi nebenbei, und ohne es zu wollen, erschütternde Einblicke in eine relativ lieblos verlaufende Kindheit um Neunzehnhundert, in der ein Kind nicht zur Projektionsfläche für wissenschaftliche Theorien wird, sondern zudem unter väterlichen Drohungen, mütterlichem Liebesentzug und darunter leidet, dass ein Pferdchen vor seinen Augen verunglückt ist – und wahrscheinlich weniger an uneingestandenen vatermördischen Absichten, oder uneingestandenen inzestuösen Gefühlen der Mutti gegenüber. Wozu dieser Exkurs ins Wien des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, wo wir doch eigentlich im Italien des Jahres 1964 sind? Weil die Prologsequenz von 5 TOMBE PER UN MEDIIM sich als ein atemloser Kurzfilm präsentiert, der die wichtigsten Freud’schen Symbole zu einem dichten Gewebe zusammenschnürt. Der kleine Hans ist groß, und trinkt zitternd und schweißgebadet ein Glas Hochprozentiges in Großaufnahme. Das Quietschen eines Pferdekarrens ist zu hören, Hufgetrappel. Zoom auf eine Glastür, wo ein Arm ihre Außenseite begrabscht. Flucht des Mannes aus einer verlassenen Schenke in einen Traum für jeden Freund gepflegter Schwarzweißphotographie. Die Kamera folgt ihm in einem anmutigen Schwenk, während er durch verlassene Dorfgassen eilt, und schließlich in einem Pferdestall landet, wo er sein Reittier satteln und die Flucht auf vier Beinen fortsetzen möchte. Soweit kommt es nicht: Von der Tonspur dröhnt und trommelt es. Kein Wunder, dass sein Gaul durchdreht und die Hufe spielen lässt. Das Ende des Lieds: Unser Held liegt mit zerschmettertem Schädel – ein Auge guckt vorwurfsvoll aus dem Matsch seines Kopfes in die heranzoomende Kamera – im Heu, und der Titel des Films kann erscheinen. Kann man schöner darstellen, dass ein vor der imaginären Entmannungsschere Fliehender letztlich von einem Penis, der größer ist als der seine, den eigenen amputiert bekommt als in diesem Ensemble aus animalischer, ophthalmischer und konkret-physischer Schwanz-Surrogate? Noch schöner: Pupillos Interpretation ödipaler Triebregungen findet nicht in einer sterilen Seelenklempnerpraxis stattfindet, sondern inmitten der üppigsten Auswüchse des gotischen Grusels.

Abb.2: Die Kräfteverhältnisse sind natürlich klar abgemessen. Winzig erscheint Alberts Automobil im Vergleich zu den Säulenstempeln, die das Schloss von Bregonville bewachen. So nützlich das technische Vehikel auch ist, so wenig Chancen hat es gegen die rein ornamentale Natur der Vergangenheit. Nach einem Schwenk sehen wir übrigens gleich das Hauff-Anwesen, auf das das Auto zufährt, und erneut vor seiner historischen Größe klein wird wie eine Fliege.
Die bürokratische, durchrationalisierte, mit Paragraphen und harten Fakten operierende Moderne ist indes nur einen Schnitt entfernt: Wir wechseln in eine Rechtsanwaltskanzlei, wo gerade einer der beiden Notare, Joseph Morgan, seinen Hut genommen hat, um übers Wochenende zu einem wichtigen Termin zu eilen, und sein Kollege Albert Kovac deshalb statt seiner einen offenbar dringlichen Brief entgegennimmt, in dem ein sterbender Schlossbesitzer namens Hauff um die Anwesenheit eines Rechtsgelehrten bei dem Aufsetzen seines Testaments bittet. Zwar wundern sich Kovac und Sekretärin ein bisschen über die Handschrift des Verfassers, denn „so schreibe seit Jahrhunderten niemand mehr“, doch natürlich kann man, wie Kovac anmerkt, einem Totgeweihten selbst am Vorabend des Wochenendes seinen letzten Wunsch nicht abschlagen, und schon tritt der nominelle Held unseres Schauerstücks eine Reise an, die ihn in eins jener Paralleluniversum bringt, wie wir es auch aus vergleichsweise Hammer-Produktionen kennen: Da gibt es Leute mit Nachnamen wie Nemek, Stinner oder eben Hauff, und Ortschaften namens Kravitz, Ratzen oder Bregonville, und über manchen Läden sind deren Funktionsbezeichnungen – wie bei einer „Apotheke“ – in Deutsch angegeben. Das ist natürlich eine Verbeugung an die Genre-Tradition. Schon Poe wusste, dass der Schrecken aus Deutschland kommt, und spielt damit auf den immensen Ausstoß trivial-unterhaltsamer Geistergeschichten, Raubritterromane und Räuberpistolen aus deutschsprachigen Ländern Ende um Achtzehnhundert an. Seine erste veröffentlichte short story von 1836 heißt dementsprechend auch noch METZENGERSTEIN, Untertitel: A TALE IN THE TRADITON OF THE GERMAN, und spielt in einem pseudo-mittelalterlichen Phantasie-Ungarn, und ja, auch ein grusliger Gaul hat eine tragende Rolle in ihr inne. Während es nicht viel Sinn macht, der Topographie des Films mit geographischen Kenntnissen auf die Pelle zu rücken, lässt sich exakt indes seine temporale Verortung bestimmen: Wir befinden uns im Frühjahr 1911 – um genau zu sein: im Mai –, denn, wie Kovac erfährt, als er endlich im Schloss von Bregonville ankommt, hat dessen Besitzer bereits vor einem Jahr das Zeitliche gesegnet, während seine Erben – Töchterchen Corinne, die natürlich sofort ein Auge nach Albert wirft, der dieses geschickt aus der Luft zu fangen weiß, sowie Stiefmutter Cleo, die derart unterkühlt und fahl daherkommt, dass der Heizboiler Überstunden leisten muss – sich nicht erklären, wer denn in seinem Namen einen solchen Brief geschickt haben soll: Ist ein makabrer Scherz, eine Verwechslung, eine Notiz aus dem Jenseits? Immerhin ähneln Schrift und Siegel denen des Verstorbenen wie ein Ei dem anderen. Klar, Albert verbringt die Nacht im Schloss, und erfährt dessen Geschichte von der aufmerksamen Corinne: Errichtet sei es auf einem Lazarett des fünfzehnten Jahrhunderts, in dem Pestkranke untergebracht worden sind. Einige von ihnen seien losgezogen, um die Bewohner der umliegenden Dörfer mit ihrer tödlichen Krankheit zu infizieren. Ihre zur Strafe dafür abgehackten Hände kann man noch in Vitrinen im Arbeitszimmer ihres toten Papas bestaunen, und die Gräber der Unglückseligen hinterm Schloss auf dem Acker. Ob Hauff ein ernstzunehmender Forscher gewesen sei, oder nur jemand, der es liebte, seine Besucher zu erschrecken, fragt sich der zunehmend irritierte Albert nicht nur angesichts der wie selbstverständlich ausgestellten Totenhände, sondern auch des Faktotums Kurt, seinerzeit Hauffs buckliger Bediensteter, der immer noch stumm durch die Gemächer schleicht.

Abb.3: Ein Kamera-Zoom in die Vergangenheit: So sah das Gelände des Hauff-Anwesens früher aus, als da noch ein Siechenlazarett stand, in dem die Pest wütete. Überall in diesem Gemäuer tun sich solche Schlüssellochblicke auf - am Ende ganz leiblich, wenn sich Sargdeckel heben und konservierte Hände zu Wuseln anfangen.
Etwas unterscheidet 5 TOMBE PER UN MEDIUM von ähnlich gelagerten Filmen der italienischen Massenproduktion gotischen Grusels – und das kann man ihm dann doch, mit einigem Biegen und Brechen, als kleine Reminiszenz an die Spezifik von Poes Oeuvre anrechnen. Poe operiert, wie gesagt, mit einem Teil seines literarischen Bestecks im traditionellen Repertoire der Schauerromantik, und mit dem andern in einem rein psychologischen Grauen, das sich aus menschlichen Extremsituationen wie Folter, Wahnsinn oder sexuellen Obsessionen speist. Da gibt es hübsche Frauenleichen, die sich als Scheintote entpuppen, und an traurigen Seen liegende Herrschaftshäuser, und vatikanische Verließe im Zwielicht schlotternder Funzeln, wie man das aus Standardwerken der Gothic Novel von Ann Radcliffe oder Clara Reeve oder Horace Walpole kennt. Da gibt es auch die langsam anschwellende Manie, einen eigentlich harmlosen Menschen zu ermorden, eine Fixation auf die Zähne eines jungen Mädchens, oder mesmeristische Experimente, die ein Leben nach dem Tod ermöglichen sollen. 5 TOMBE PER UN MEDIUM ist ein Film, der diese beiden widerstreitenden Pole direkt an seiner Fassade aushandelt. Schon der Pferdchentraum zu Beginn, indem einfach mal psychoanalytische Theoretisieren im Gewand wohligen Schauders daherkommt, sowie die Wahl des Jahres 1911 deutet auf eine den Film strukturierende Hybris hin: Albert reist nicht mit der obligatorischen Kutsche ins Hinterland, sondern mit seinem Privatwagen. Der tote Hauff hat eine Wachswalze voll Tonaufzeichnungen hinterlassen, wo er, wie Van Helsing in Bram Stokers DRACULA, seine Forschungsergebnisse bezüglich der Siechenvergangenheit des eigenen Schlösschens zum Besten gibt, und, nebenbei, seinerzeit moderne Technik unserem Helden Albert, metaphysischem Grauen auf den Leib rücken. Zugleich aber ist Bregonville ein Ort, der beinahe in seiner morbiden Vergangenheit ersäuft, voller Gemälde, Statuetten und sonstiger Artefakte, die so tun, als sei die Zeit gemeinsam mit ihnen erstarrt. Wunderschön bringt die Szene, die erklären soll, weshalb Albert am nächsten Morgen nicht zurück ins Büro gelangt, sowohl die Diskrepanzen zwischen Progression und Tradition auf den Punkt, sondern führt sie außerdem auf wirklich aberwitzige Weise zusammen. Zwiespältig steht das Hausmädchen der Hauffs Alberts Auto gegenüber. Sie sagt, ihr Großvater habe sie immer vor den Dingern gewarnt. Trotzdem ist sie neugierig: Fährt das denn dann von selbst? Albert kurbelt derweil, um den Motor in Bereitschaft zu versetzen. Da dringt ein Geräusch unter der Haube hervor, als ob man einer Katze auf den Schwanz getreten hätte. Als er einen Blick ins Innere des Fahrzeugs wirft, stellt er fest, dass sich eine Eule im Getriebe verfangen hat. An eine Weiterfahrt ist nicht zu denken. Der regelrecht zerfledderte Vogel verklebt und verkeilt den Motor. Es ist ein Angriff der vergangenen auf die gegenwärtige Zeit, so, als sei der Nachtvogel aus dem berühmten Goya-Gemälde vom Schlaf/Traum der Vernunft herbeigeflattert, um das Herandrängen der technologische Moderne in die Einöde von Bregonville durch den Einsatz des eigenen Lebens vernichtend zurückzuschlagen. Albert jedenfalls bleibt nichts übrig, als erst einmal vor Ort zu bleiben, sich in Corinne zu verknallen, zusammen mit dem Dorfarzt Dr. Nemek dem Rätsel um einen briefeschreibenden Verstorbenen nachzugehen, und sich alsbald dem noch größeren Rätsel gegenüberzusehen, dass alle fünf Zeugen, die den Tod Hauffs miterlebt haben – er soll sturzbesoffen eine Treppe runtergestürzt sein – entweder bereits innerhalb eines Jahres von Herzlähmung dahingerafft worden sind, oder ihnen jetzt vor den Augen wegsterben: Den Bürgemeister Berit beispielweise finden sie zusammen leblos in der Apotheke, und kurz darauf knüpft sich Zeuge Nummer vier, der paralysierte Stinner, in seiner Stube auf. Nur der fünfte Mann fehlt noch? Wer er ist, weiß niemand, da sein Name auf dem Totenschein unleserlich ist…

Abb.4: Weshalb sich eine Reminiszenz an Carl Theodor Dreyers VAMPYR entgehen lassen, wenn man die Gelegenheit dazu hat? Nachdem sich der paralysierte Stinner aufgeknüpft hat, schneidet ihn ein Polizeibeamter vom Deckenbalken, und tritt dabei zunächst einzig als körperloser Schatten in Erscheinung.
5 TOMBE PER UN MEDIUM ist kein oberflächlicher Film. Seiner Struktur selbst werden immanent die Dispositive der Umbruchszeit eingeschrieben, in der er spielt. Wie ein hard-boiled Privatermittler irgendeines film noir erläutert Albert mit einer zugleich reflektierten wie coolen Stimme uns immer mal wieder seine Gedanken und Gefühle. Nachdem erstmal das Arsenal an gänsehauterzeugenden Kulissen und Charakteren etabliert worden ist, kippt der Film in eine Krimihandlung, bei der es erst um Deduktion und Feinanalyse geht, und dann darum, den Cast in zwei Gruppen einzuteilen: Die strahlenden Helden aus dem Bilderbuch, und die ganz Verworfenen, an denen Mario Bava seine Freude gehabt hätte. Manche Szene kommt mir daher wie aus einem Experimentalfilm. Wie göttlich einfach nur, wie das Hausmädchen der Hauffs durch einen Wald stapft, und dazu ein Knarren ertönt, als würden wir, wie in Ingmar Bergmans PERSONA, gleich dem Film selbst beim Rollen und vielleicht zuhören. Wie zum Sich-Darin-Suhlen einladend einfach nur die Schwarzweißphotographie von Carlo di Palma, der genau weiß, wann welcher Schatten welchen lichten Fleck verschlucken muss, und wann in welchem Meer aus Schwarz wo ein heller Punkt auflodern soll. Wie rhythmisch die Montage, wenn sie immer mal wieder die narrative Dynamik für ein paar Sekunden zum Verweilen animiert, und sich zusammen mit einem überlauten Tonspur-Ticken ganz darin gefällt, Großaufnahmen von sich in Gang setzenden Uhren aneinanderzuheften. Wie nett auch, Luciano Piggozi als Diener Kurt zu sehen, und Barbara Steele als unnahbare femme fatale, und Walter Brandi als Schwiegermutters Liebling. Nicht zuletzt: Was für einen Teufel mag die insgesamt vier Drehbuchautoren geritten haben, den Film – statt ihn einer logisch nachvollziehbaren Auflösung entgegenzuführen – in der letzten Viertelstunde dann noch einer surrealistischen Invasion an Eigenheiten zu opfern, bei der die ausgestopften Pestkrankenhände das Grapschen beginnen, ein kleiner Junge plötzlich mitternächtlich trällernd an einem Brunnen erscheint, und nur reinigendes Wasser Protagonisten und Antagonisten davor bewahren kann, vorm plötzlich um sich greifenden und in Sekundenschnelle mordenden Schwarzen Tod gerettet zu werden. Verstanden habe ich zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr, was da eigentlich gerade vor meiner Nase passiert. Klar ist nur: Auch wenn das Getriebe noch etwas weitergetuckert hat, es sind zu viele Eulen, viel zu viele, als dass sich aus seinem Gestotter noch etwas Sinnloses herauslesen ließe. Bei der großflächigen Kontamination der Physik durch die Metaphysik bleiben letztendlich keine Zweifel daran, für wen oder diese kleine, schmucke, und unverständlicherweise von mir jetzt erst entdeckte bunte Tüte betörender Bilder Partei ergreift. Auch Pupillo, der Mitte der 60er einen Lauf gehabt zu haben scheint, und die Welt 1965 nicht nur mit 5 TOMBE PER UN MEDIUM, sondern noch mit zwei weiteren Gothic-Horror-Stücken - LA VENDETTI DI LADY MORGAN sowie IL BOIA SCARLATTO – zu einem besseren Ort gemacht hat, gehört allein angesichts vorliegenden Films nun wirklich nicht mit dem Gesicht zur Wand in die Trash-Ecke, sondern in jenen so schwierig fassbaren Grauzonenbereich zwischen Avantgarde-Sensibilitäten, Erzählkino und Lust am Trivialen, an der ich mich nicht sattsehen kann.