Re: Salvatores Skizzen zu einer Studie der absoluten Kontingenz
Verfasst: So 9. Dez 2018, 15:41

Originaltitel: Sacerdos
Produktionsland: Deutschland 2012
Regie: Lars Kelich
Darsteller: Heiderose Hoja, Philipp Kreisz, Lars Kelich
Auch in Stadtbibliotheken kann man zuweilen über absonderliche Filme stolpern, die es einem danken, wenn man einen freien Tag damit verbringt, sich ihnen diskursiv anzunähern. So geschehen in der Hannover Stadtbibliothek, in deren Bewegtbildmedien-Abteilung mich kürzlich eine DVD mit dem schönen Titel SACERDOS angelächelt hat. Abgebildet ist darauf, neben dem Schriftzug in stilisiertem Bluttriefen, eine bekuttete Gestalt, offenbar gerade dabei, einer wehrlosen Maid einen Knüppel über den Kopf zu ziehen. Einen kurzen Gang zur Ausleihtheke und eine kurze Recherche später weiß ich: Bei den Verantwortlichen hinter SACERDOS, der Produktionsfirma Utopian Pictures, handelt es sich um eine Amateurfilmemachergruppe aus Hannover, deren Alleinstellungsmerkmal es ist, dass sich ihre Drahtzieher allesamt politisch innerhalb der lokalen SPD betätigen. Ein Artikel in der Hannoverscher Allgemeinen vom 7.10.2015 vermerkt dazu: „Ihr Parteibuch ist so rot wie das Kunstblut in ihren Filmen.“ Auch sonst ist der Artikel aufschlussreich, was das Selbstbild der Gruppe um Lars Kelich, seine Frau Heiderose Hoja, und Philipp Kreisz angeht. Der deutsche Amateurfilm, behauptet SPD-Ratsherr Kelich, Gründer der Truppe, sei schon immer politisch gewesen, und verweist dabei auf die seligen 80er und 90er, als er sich selbst als Teenager noch mächtig verbotene Index-Filme aus den Videotheken Niedersachsens auslieh. Splatter- und Gorefilme als Gegenprogramm zur spießigen CDU-BRD unter Kohl und Konsorten? Die SPD dementsprechend wiederum als subversiven Projekten tendenziell offenstehende Partei der Gegen- und Subkulturen? Schauen wir uns doch einfach einmal SACERDOS mit seinen knackigen sechzig Minuten Laufzeit vorbehaltlos an. Anbei mein Sichtungsprotokoll, mit schwungvoller Schrift geschmiert auf die freien Seiten einer Gesamtausgabe der Schriften Ferdinand Lasalles.
2:20: Durch die nächtlichen Straßen Hannovers bewegen sich Laura und Lucy von der Party eines gewissen Frank nach Hause, der zwar ein richtiges Arschloch, aber immerhin gutaussehend sein soll. „Beim nächsten Mal vernasch ich ihn, ich sag’s Dir!“, versichert Lucy ihrer Freundin, bevor sich die Wege der beiden jungen Damen trennen, und erstere in eine verlassene Gasse abbiegt, wo sie sogleich Opfer einer Fulci-Reminiszenz wird: Eine Gestalt in Mönchskutte zaudert, als sie Lucy in ihre Fänge bekommen hat, nicht lange, ihr das rechte Auge noch in seiner Höhle zu zerquetschen. Furchtbar gellen die Schreie der jungen Frau durch die schlafende Stadt an der Leine…
7:00: Schon während des Vorspanns – (der übrigens von einem Instrumentalstück unterlegt ist, das ungelogen von der italienischen Band Antonius Rex stammen könnte, die in den 70ern und 80ern irgendwo in der Schnittmenge zwischen Progressive Rock, Electro-Industrial und Pseudo-Horrorfilm-Soundtracks operierte; es hört sich an, als habe man eine Variation des HALLOWEEN-Themas mit einem viel zu lauten, viel zu sterilen Drum-Computer, sphärischen Synthies und deplatzierten akustischem Gitarrengezupfe kurzgeschlossen) – lernen wir Oberkommissar Richard Schumacher kennen, der offenbar sturzbesoffen und mit dem Flachmann im Anschlag von der Kneipe, in der er die Nacht verbracht haben muss, zu seinem Arbeitsplatz torkelt. Einige Stadtimpressionen Hannovers und besorgten/vorwurfsvollen Blicken zweier Kollegen später erhält Schumacher einen Anruf, der ihn nicht schlagartig nüchtern macht, aber zumindest schon mal langsam in den Arbeitsmodus versetzt: Er soll sich um 15 Uhr in der Gerichtsmedizin einstellen, denn eine übelzugerichtete Leiche sei gefunden worden. Darauf erstmal einen kräftigen Schluck Chantré. (Angemerkt sei hier, dass Philipp Kreisz jedes Mal – und das wird sich leitmotivisch durch den gesamten Film ziehen –, wenn er sich an seinen Mini-Spirituosen ergötzt, nur so tut, als würde etwas von deren Flüssigkeit in seinen Mund geraten. Sein Trick: Er ballt die Faust so um die Fläschchen, dass wir angeblich nicht sehen, wie viel von deren Inhalt tatsächlich hinter seinen Lippen verschwindet. Der Fehler seiner Tricks: Wir sehen es natürlich trotzdem. Ich weiß, das ist ein irrelevantes Detail, aber mal ehrlich: Man hätte doch wenigstens die Chantré-Fläschchen mit Apfelsaft auffüllen können, wegen Realismus und so...)
10:45: Laura hat verpennt. Verkatert wühlt sie sich aus ihrem Bettchen. (Verkatert von was eigentlich? Auf dem Nachhau-sewegnachts zuvor haben Lucy und sie noch völlig nüchtern gewirkt.) Als sie bei ihrer Freundin, mit der sie eigentlich zum Joggen verabredet gewesen ist, durchruft, meldet sich verständlicherweise nur deren Mailbox. Grund genug für Kelich, uns anschließend endlos lange und sogar vergleichsweise aufwändig aus verschiedenen Kamerawinkeln gefilmt, seine spätere Ehefrau und damalige Lebensgefährtin Heiderose beim Zähneputzen und - freilich ohne explizite Einblicke -, beim Duschen zu zeigen. Na gut, aufregend ist das nun nicht wirklich.
11:50: Oberkommissar Schumacher scheint nicht nur eine Vorliebe für hochprozentigen Alkohol in handlichen Fläschchen, sondern ebenso für geschmacklose One-Liner zu haben, denn beim Anblick der hingemetztelten Lucy in der Gerichtsmedizin fällt ihm nichts Besseres ein als: „Schau mir in die Augen, Kleines!“ zu frotzeln. „Ein echter Pirat sticht auch ins rote Meer“, merkt er kurz darauf noch an, nachdem der Pathologe (niemand Geringeres als Regisseur Kelich höchstselbst) ihm zu erklären versucht hat, dass das Opfer offenbar an dem durch den Verlust des Auges verursachten Schmerzes gestorben sein soll, 1,1 Promille im Blut gehabt habe (davon habe ich nun aber, wie gesagt, nicht wirklich was gemerkt), und ein Sexualmord ausgeschlossen werden könne.

Abb.1: Ein seltenes Exemplar des Gemeinen Hannoveranischen Schluckspechts, auch bekannt als Kommissar Schumacher vom Morddezernat der Niedersächsischen Landeshauptstadt.
20:00: Laura muss alleine die zu sich genommenen Alkoholkalorien des Vorabends abtrainieren. Das gibt dem Film nicht nur Gelegenheit, weitere kostbare Zeit damit totzuschlagen, dass er seine Heldin zu diesem mich inzwischen bereits gelinde nervenden Klavierthema durch die Pampa hetzt, sondern auch, sie beim Ausruhen auf einer Parkbank mit dem mordenden Mönch zu konfrontieren, der ihr an die Gurgel springt – aber, zum Glück!, alles war nur ein Tagtraum. Was sich Laura jedoch nicht einbildet, ist, dass Lucy sie endlich anruft – nur: am andern Ende ist nicht ihre Freundin, sondern Schumacher, der scheinbar wahllos das Handy-Adressbuch der Toten durchstöbert hat. Der folgende Dialog ist eins der schillerndsten Goldstückchen des gesamten Films: Schumacher stellt sich als von der Mordkommission vor, Laura fragt verwirrt, wie er denn an Lucys Mobiltelefon komme, Schumacher mag darüber aber nur persönlich mit ihr sprechen, und schlägt vor, dass sie sich treffen, so gegen 18 Uhr?, worauf Laura ihm verspricht, ihm ihre Wohnadresse per SMS an Lucys Handy zu schicken, da der Oberkommissar, scheint’s, nicht fähig ist, eigenständig herauszufinden, wo potentielle Zeugen in einem Mordfall wohnhaft sind. Dass Schumacher, wie er deutlich betont hat, von der Mordkommission ist, scheint bei Laura auch nicht unbedingt angekommen zu sein, denn als sie sich gleich darauf mit einem gewissen Eric trifft, stammelt sie nur diffuses Zeug wie, dass sie glaube, jemand sei hinter ihr her, eine Figur in einer Kutte, dass es möglich sein könne, Lucy sei irgendetwas zugestoßen, und dass auch er, Eric, in Gefahr schweben könne. Der Knabe nimmt das zumindest so lange auf die leichte Schulter bis sein Nachhauseweg sich mit dem des frommen Bruders kreuzt, dieser ihm erst nachstellt – (und zwar in einem Tempo, auf das die Etrusker in Bianchis LE NOTTI DI TERRORE neidisch wären) -, sich dann entscheidet, in den „Wir-können-uns-überall-materialisieren-wo-wir-wollen“-Modus der Fulci-Zombies à la PAURA NELLA CITTÀ DEI MORTI VIVENTI zu wechseln, Eric frontal mit einem Stein zu attackieren und ihm den Kopf zu Klump zu kloppen.
23:45: Es wird Zeit für einen neuen Charakter, oder? Sie heißt Diana, ist die Mitbewohnerin Lauras, und findet Schumacher im Vollrausch vor ihrer Haustür lungern, wo er sich mit „Ich bin der Osterhase mit den dicken Eiern“ vorstellt. Ein Saxophon quäkt unangenehm von der Tonspur. Das folgende Gespräch mit Laura unter vier Augen in deren Küche ist kaum behaglicher, denn außer ein paar unbestimmten Fragen, ob Lucy denn einen Ex-Freund besessen habe, der ein Interesse daran haben könnte, dass sie nun nicht mehr unter den Lebenden weilt, hat er nun wirklich nicht viel auf Lager, um aus Laura mögliche Täter oder Motive hervorzulocken. Immerhin frappiert mich in dieser Szene wohl das Artefakt des Films, das mir noch in Jahren im Gedächtnis verbleiben wird: Die Junggenossinnen und Junggenossen haben auf ihrer Küchenanrichte doch tatsächlich einen SPD-Toaster stehen!
27:05: Um den Kopf freizubekommen, spaziert Laura durch eine Schrebergartenkolonie. Problem ist nur, dass der Metzelmönch genau die gleiche Idee hat, und sich alsbald erneut an ihre Fersen heftet. Mit dem Leben kommt sie nur davon, weil irgendein Passant dem Kuttenträger vor die Füße läuft, und nun statt Laura ein Messer in die Wampe empfängt. Die findet bei ihrer Heimkehr Diana mit ihrem Freund Christian im Wohnzimmer vor, wo der beim Anblick der Mitbewohnerin aufstöhnt: „Ich dachte, wir hätten den Abend für uns.“ Beide, Diana wie Christian, halten Lauras inkohärentes Gestammel von einem sie verfolgenden Ordensbruder eher für Gespinste ihres durch den Mord an Lucy ordentlich durchgerüttelten Hirns. „Mönche machen sowas nicht!“, erklärt Christian ihr im Brustton der Überzeugung, was bedeutet, dass er scheinbar weder jemals Alfred Vohrers DER MÖNCH MIT DER PEITSCHE, Adonis Kyrous LE MOINE oder, erneut, Bianchis LE NOTTI DEL TERRORE gesehen haben dürfte.
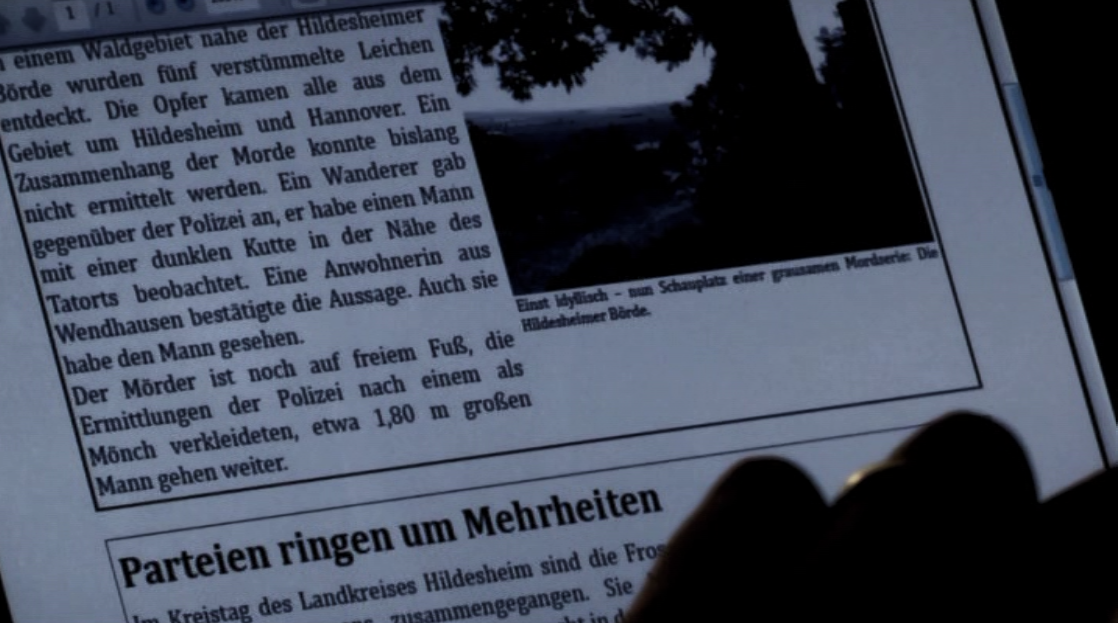
Abb.2: Laura auf Recherche: "Einst idyllisch -nun Schauplatz einer grausamen Mordserie". Darunter ringt die SPD offenbar um Mehrheiten.
31:15: Auf welch wackligen Stelzen Christians These steht, Mönche hätten generell nichts mit Straftaten der eher kruden Sorte zu tun, beweist Laura bereits eine flüchtige Internetrecherche. Erst kürzlich wurden nämlich nahe der Hildesheimer Börde fünf grausam verstümmelte Leichen gefunden – und ein Wanderer will unweit des Tatorts einen Mann in einer Kutte erspäht haben! Laura scheint Oberkommissar Schumacher bereits gut genug zu kennen, dass ihr klar ist: Alleine wird der auf diesen Internetartikel beim besten Willen nicht stoßen, geschweige denn Verbindungen zur Ermordung ihrer Freundin ziehen. Deshalb ruft sie bei ihm im Büro an, wo allerdings keiner seiner Kollegen weiß, wo er steckt – da es Samstagabend sei, könne sie es aber einmal in seiner Stammkneipe versuchen. Christian, der eigentlich mit Diana einen bräsigen Fernsehabend verbringen wollte, ist gar nicht von Lauras Bitte begeistert, sie doch zu Schumachers Schnapshölle zu fahren. Weder empfänglich für Fernsehkrimis noch für Kneipentouren hat unser Mönch indes nichts Besseres zu tun, als mitten auf der Fahrbahn darauf zu warten, dass Laura, Diana und Christian direkt auf ihn zurasen, und Christian, als er nach einer Vollbremsung nachschaut, was er da denn gerade gerammt hat, ins Gebüsch zu zerren. Statt dass Laura und Diana ihrem Freund zu Hilfe eilen, drücken sie lieber auf Vollgas, rasen zur Stammkneipe Schumachers, die sich als recht ansehnliches Griechisches Restaurant entpuppt, und zerren wiederum den vor lauter Fusel zu keiner Silbe mehr fähigen Oberkommissar hinter seinen Uzo-Gläschen hervor.
33:20: Was genau Schumacher nun in dieser Nacht noch ausrichten konnte, das werden wir nie erfahren, da Laura und Diana nach einem Schnitt mit hängenden Gesichtern am nächsten Morgen um den Küchentisch herumsitzen. „Oh Gott, ist das gestern wirklich passiert?“, fragt Diana nun überhaupt nicht im Tonfall von jemandem, der gerade seinen Liebsten an einen mordenden Mönch verloren hat. „Ich hoffe, die Polizei kriegt den Mistkerl!“, lautet die Phrase, die bei Laura als nächstes vom Stapel läuft. Wo Worte versagen, müssen Taten her – und stilsichere SPD-Kaffeetassen, die Laura direkt neben dem Toaster zu einem blutroten Ensemble drapiert, als sie ihrer Freundin und sich in einer weiteren dieser zeitstreckenden Einstellungen, von denen der Film nicht wenige hat, die schwarze Koffeinbrühe einschenkt. Dass Chorgesänge dazu erklingen, macht es absurder, aber nicht unbedingt besser. Ach ja, inzwischen hat man auch endlich Eric aufgefunden. Schumachers Kommentar, als er dessen zerschmettertes Gesichtchen sieht: „Das Clearasil kannst Du Dir jetzt sparen, Junge!“
41:30: Endlich erfahren wir, was Laura eigentlich beruflich macht, nämlich an der Leibnitz-Universität in Seminaren zur Hexenverfolgung zu sitzen, in denen die Dozenten scheinbar die Zusammenfassungen von Zusammenfassungen von Brockhaus-Artikeln vorlesen, und als Primärliteratur sowohl Richard Dawkins‘ „Der Gotteswahn“ als auch Karlheinz Deschners „Kriminalgeschichte des Christentums“ dient. Nachdem Laura eine Kanne Mitleid von ihren Kommilitonen übergeschüttet bekommen hat – (irgendwie wirkt es auf mich aber eher so, als ob die nur Jagd auf besonders sensationsträchtige Einzelheiten der in Lauras Umfeld grassierenden Mordserie machen wollen würden) -, und Laura die Besorgnis geäußert hat, auch sie, ihre Kommilitonen, könnten alsbald ins Visier des unbekannten Killers geraten, erhält sie während des Seminars eine SMS von Diana, in der diese ihr mitteilt, der totgeglaubte Christian sei auf einmal wiederaufgetaucht. Die Beine in die Hände nehmend eilt sie aus dem Universitätsgebäude – und kollidiert zuerst mit dem messerschwingenden Mönch, und gleich darauf mit Schumacher und seinem bisher unsichtbaren Kollegen Schmidt, die offenbar genau gewusst haben, dass Laura ihr Seminar frühzeitig verlassen und ausgerechnet diesen Weg nach Hause nehmen wird. (Na gut, Schumacher erklärt, Diana habe ihnen verraten, welche Strecke Laura üblicherweise zurücklegt, aber haben die Beamten nun wirklich stundenlang am Wegesrand gewartet, und sind nicht einfach zu Laura ins Seminar gegangen?) Was genau wollen die Beamten von unserer Heldin? Nun, sie erstmal mit ins Präsidium zu nehmen, denn inzwischen ist auch die Leiche in der Kleingartenkolonie entdeckt worden, und man hat daher noch weitere Fragen an sie, das heißt: Schumacher gibt das Geleit, während Schmidt zurückbleibt, um den Mönch, der ja angeblich noch irgendwo im Park versteckt sein muss, über den Haufen zu schießen. Tatsächlich stellt er den Unhold, und pumpt ihn mit drei Kugeln voll, doch nachdem die Kutte zusammengesackt ist, löst sie sich in Luft auf, und lässt einen verdutzt umherwuselnden Polizisten zurück.
47:20 Lange darf Schmidt nicht verdutzt umherwuseln. Nachdem die neuerliche Vernehmung Lauras schon wieder keine Erkenntnisse zutage gefördert hat, die Schumacher schmecken, soll Schmidt sie am nächsten Tag bei einer Exkursion begleiten, die sie mit ihrem Hexen-Seminar zu irgendwelchen mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Ruinen unternehmen wird. (Ob ich nun, wenn ich um mein Leben fürchte, bereits mehrere Mordanschläge nur knapp überlebt hätte, und außerdem mein halber Freundeskreis von einem unheimlichen Mönch dezimiert worden wäre, tatsächlich meine Prioritäten so setzen würde, dass ich eine Uni-Exkursion nicht doch vielleicht ausfallen ließe, bleibt fraglich.) Schmidt kommt aber nicht weit: Erst vergisst er in Schumachers Büro seine Dienstwaffe, dann schenkt ihm der Mönch im Parkhaus seine Aufmerksamkeit, und macht kurzen Prozess mit ihm. Währenddessen sitzt Christian quicklebendig bei Diana und Laura auf der Wohnzimmercouch, und erzählt, er wisse selbst nicht, weshalb der Mönch ihn am Leben gelassen habe. Was Christian aber inzwischen im Gespräch mit einem gewissen Pfarrer Carstens herausgefunden hat, präsentiert er den Mädels brühwarm – (ernsthaft, Du hast Deine Freundin im Glauben gelassen, Du seist ermordet worden, und hast, statt Dich bei ihr wenigstens kurz zurückzumelden, erstmal Deinen Gemeindepfarrer besucht, eh?): Angeblich spuke in der Gegend eine Legende herum, die von einem kirchentreuen Mönch berichtet, der im Jahre 1796 schreckliche Verfehlungen der Amtskirche aufgedeckt habe – so im Stil: der Bischof treibt Unzucht mit Minderjährigen usw. -, und deshalb von einem aufgebrachten Mob auf Geheiß des Klerus bei lebendigem Leibe bestattet worden sei. Überraschend kompetent jedenfalls fällt die begleitende Rückblende aus, bei der nicht an hübsch ausschauenden Mittelaltermarkt-Kostümen und einem historischen Ambiente gespart worden ist, das tatsächlich mal ein Klostergarten hätte gewesen sein können. Ein Anruf Schumachers unterbricht das Schwelgen in der Vergangenheit: Er will wissen, ob Laura wiederum wisse, wo Schmidt steckt, und nein, die weiß es nicht, und nein, sie braucht auch keinen Polizeischutz für die Exkursion morgen – eine Aussage, die ich äußerst fragwürdig finde.

Abb.3: Standardlektüre in Seminaren zur Hexenverfolgung an der Leibnitz-Universität: Karlheinz Deschners "Kriminalgeschichte des Christentums" und Richard Dawkins' "Der Gotteswahn".
1:00:00: Zeit für das Grande Finale. Die große Exkursionsgruppe besteht zwar nur aus sechs Köpfen, dafür sind alle versammelt, die wir bislang liebgewonnen haben: Neben der unvermeidlichen Laura noch Christian und Diana, der spießig-zugeknöpfte Dozent von vorhin namens Professor Egebrecht, und eine Dreiergruppe, bestehend aus einer Dame und zwei Herren, unter der Führung eines gewissen Björn, die scheinbar noch nicht aus der Pubertät herausgelangt sind, denn anders kann ich es mir nicht erklären, dass Björn einen verstauchten Knöchel vortäuscht, um mit seinen beiden Mitstreitern zurückbleiben zu können, und, während der Professor mit unserer Helden-Trias weiter durchs Unterholz stapft, erstmal einen Joint und eine Pfefferminzschnaps-Pulle auspackt. Der Verzehr schlägt aufs Gemüt, und kichernd wie die Kleinsten kullern die drei Tunichtgute auf dem Waldboden herum, jedenfalls so lange bis der Mönch sie in altehrwürdiger Slasher-Manier wittert, nach der jeder, der nur in die Nähe von vorehelichem Sex oder Drogen gerät, sogleich mit erheblichem Blutverlust rechnen darf. Auch Schumacher ist im Wald unterwegs, auf der Suche nach der zu beschützenden Laura, und findet die Gruppe bei einem Türmchen just in dem Moment, als Christian plötzlich seine brave Fassade fallenlässt, und Diana, Laura und dem Professor die ganze Wahrheit über den Metzelmönch unterbreitet: Er selbst habe gemeinsam mit Pfarrer Carstens und irgendwelchen katholischen Burschenschaftlern den ruhelosen Bruder beschworen, um mittels seiner alle die Sünder zu bestrafen, die Gottes Gesetze mit Füßen treten. „Ich werde erlöst sein!“, krakeelt er in einer der melodramatischsten Todesszenen, die ich seit langem gesehen habe, und stürzt sich in Schumachers losbellende Pistole. Ein unüberschaubares Gemetzel folgt, bei dem der Geschichtsprofessor ebenfalls seines Lebens verlustig geht, es Laura aber schließlich schafft, Schumachers Knarre in die Finger zu bekommen, und den Mönch niederzuschießen. Wider Erwarten, denn bei Schmidt zehn Minuten zuvor hat das ja nicht so einfach funktioniert, bleibt er mausetot liegen. (Liegt es daran, dass Laura ihm eine Kugel direkt in die Stirn jagt, und damit endlich jemand ist, der die Lehren, die wir aus Fulcis L’ALDILÁ gezogen haben, beherzigt?) In einem Feld voller Leichen können Schumacher, Laura und Diana nur noch erschüttert dreinblicken. Ende?
1:03:00: Nein, fast, ein skizzenhafter Epilog folgt noch, angesiedelt ein Jahr später: Laura und Diana verlassen das Wilhelm-Busch-Museum in Hannover – (fragt mich nicht, was die Grazien dort nun schon wieder verloren hatten) -, schlendern gutgelaunt über eine Brücke. Die Kamera wendet sich von ihnen ab und zoomt langsam auf eine Mönchskutte, die offenkundig jemand achtlos an den Wegesrand ins Gras geschmissen hat. Um Himmels willen! Der Abspann ist mit niedlichen Zeichnungen des Mönchleins und einem Soundtrack untermalt wie aus einem epischen Fantasy-Videospiel. Nun aber wirklich: Ende!
Bevor ich das Drehbuch als eigentliche Schwachstelle von SACERDOS identifizieren möchte, widme ich mich erst einmal den technisch-ästhetischen Aspekten – auch deshalb, weil ich nach dieser überlangen Inhaltsangabe die spontane Lust verspüren, etwas Wohlwollendes über vorliegendes Schauerstück zu verlieren, bevor ich es gleich leider dann doch in der Luft zerreißen muss. Was die Kameraarbeit, den Schnitt, das Sounddesign, die schauspielerischen Leistungen betrifft, sieht man SACERDOS freilich von der ersten bis zur letzten Sekunde an, dass wir es mit einem Amateurprodukt zu tun haben, dessen Verantwortliche – sofern diese Bezeichnung Sinn macht – professionelle Laien sind, die ihren Film, wie das HAZ-Interview andeutet, scheinbar an freien Wochenenden mit engen Bekannten und Freunden relativ sorglos, ohne nennenswertes Budget und ohne kommerziellen Druck im Nacken, heruntergekurbelt haben – eine Sorglosigkeit, die ich anhand leiser Selbstironie auch bei den Darstellern zu spüren meine, wenn ich Philipp Kreisz beispielweise problemlos die Spielfreude abnehme, die er in seiner Rolle als dauerbetrunkener Ermittler gehabt haben muss, oder sehe, mit welcher leidenschaftlichen Manie sich Carsten Gramms im Finale in den derangierten Kosmos eines selbsternannten Gotteskriegers hineinsteigert, oder mir mit Philipp Schmalstieg als Professor Egebrecht eine klischeebehaftete Karikatur eines Historikers, wie ich sie selbst in meinem Studium kennenlernen durfte, die letzte Viertelstunde versüßt. Auf weiblicher Seite sucht man solche Bonbons zwar vergebens, aber Heiderose Hoja als Laura und Lea Gronenberg als Diana besitzen glücklicherweise nicht negatives Talent genug, mir trotz ihres eher hölzernen Spiels und unterkühlten Emotionen selbst in brenzligen Situationen geradewegs auf die Nerven zu gehen. Avantgardistisch oder aufsehenerregend sind aus technischer Sicht nun wirklich kaum eine Montagesequenz, Einstellung oder visuelle Idee. Dass Schumacher zu Beginn einen langen, vom Kamerazoom nachvollzogenen Blick ein spiralförmiges Treppenhaus hinaufwirft, irritiert allein deshalb, weil Kelich und sein Team dort einmal aus den konventionellen Schranken ihres restlichen Films ausscheren, und wenn Heiderose Hoja knapp zwei Minuten lang bei der morgendlichen Körperpflege begutachtet wird, wobei die Kamera aus Froschperspektive ihre Füße fokussiert, oder aber aus der Vogelperspektive ihr über die Schulter schaut, dann beschleicht mich eher das Gefühl, es solle mit solchen Szenen die Laufzeit des Films wenigstens auf etwas mehr als sechzig Minuten gestreckt werden. Wenigstens aber – und das hat SACERDOS den üblichen Amateur-Horror-Knallchargen der Marke Schnaas, Taubert oder Rose voraus, von denen Kelich & Co. tatsächlich Äonen trennen – versteht man in SACERDOS die Dialoge deutlich, der Schnitt ist flott genug, einen stets bei der Stange zu halten, und die Splattersequenzen sind angenehm kurz und bündig gehalten, wälzen sich also nicht in minutenlangen Primitivsmen, wie man sie ebenfalls mit den üblichen Verdächtigen assoziiert. Man merkt vielmehr, dass im Fokus der Bemühungen das Drehbuch gestanden haben muss –, und weil dieses letztlich nicht den geringsten Sinn macht, vollkommen konfus daherkommt, und sich immer mal wieder gerne selbstwiderspricht, ist es letztlich genau dieses Drehbuch, was SACERDOS schließlich das fromme Genick bricht.
In meiner Inhaltsangabe habe ich ja schon einige Logiklöcher angedeutet, die ich nun noch ein bisschen weiten möchte: Wenn ich das richtig verstanden habe, stößt der erzkatholische Christian irgendwann vor Einsetzen der Filmhandlung über die Legende von Sacerdos, und reanimiert – (wie auch immer!) – den Mönch mitsamt seines Gemeindepfaffen und irgendwelchen Burschenschaftlern. Dass man diese Szene nicht in einer Rückblende eingeflochten hat, kann ich dem Film ja noch verzeihen – (obwohl es natürlich schon schön gewesen wäre, zumal man es sich ja sogar leistet, und das sogar recht ordentlich, visuell ins Jahr 1798 abzuschweifen) –, aber die Prämisse, die der Beschwörung folgt, erschließt sich mir kein bisschen: Sacerdos, der Ende des achtzehnten Jahrhunderts gegen Missstände in der Amtskirche kämpfe, und daher den Tod fand, ist nun also als übernatürliches Wesen zurück auf Erden, und jagt gemeine Sünder. Fünf von ihnen hat er schon bei der Helmstedter Börde erwischt. Aber weshalb sind denn nun Laura und ihre Freunde ganz oben auf seiner Abschussliste? Im gesamten Film habe ich Laura oder Diana keine einzige strafwürdige Handlung begehen sehen, oder überhaupt irgendetwas, das sie selbst nach den Maßständen von 1798 den Kopf kosten könnte. (Na gut, einmal abgesehen von dem SPD-Toaster in ihrer Küche.) Hetzt der Mönch sie, weil sie Partys konsultieren, und Alkohol trinken? Aber weshalb geht es dann Oberkommissar Schumacher niemals an den Kragen, der sich den gesamten Film mindestens den Inhalt eines Weinkellers einverleibt, und stattdessen seinem Kollegen Schmidt? Überhaupt: Was soll denn Sacerdos‘ Schlachtzug letztendlich bewirken? Die Welt von allen Sünden reinigen, phantasiert Christian. Aber müsste der Mönch dann nicht, wenn DAS seine Richtlinien sind, nahezu die vollständige Menschheit ausrotten? Wie erklärt sich wiederum sein schlussendlicher Tod? Laura kann ihn problemlos mit einer profanen Waffe niederstrecken, während Schmidt daran scheitert? Überhaupt, wenn der Mönch sich beliebig überall materialisieren kann, wieso ist er dann überhaupt darauf angewiesen, seinen Opfern im Schneckentempo hinterherzuschleichen? Könnte er Laura und Gefolge nicht einfach im Schlaf überwältigen? Fragen über Fragen, die wohl deshalb um mich herumschwirren wie ein Schmeißfliegenschwarm, weil Kelich und Team zwar ein paar nette Grundideen auf die Beine gestellt, aber völlig den Leim vergessen haben, mit dem man diese zu einer homogenen Einheit verbindet. Psychologisch ist die Chose sowieso vollkommen unglaubwürdig, und dabei aber nicht witz- oder reizvoll genug, wirklich augenzwinkernd zu wirken. Dass Diana unbekümmert ihren Freund, von dem sie ja noch nicht weiß, dass er mit dem Mönch unter einer Decke steckt, in dessen Armen zurücklässt, oder dass Laura einfach nicht checkt, dass Lucy wohl tot sein wird, wenn sie ein Kommissar des Morddezernats von deren Handy aus anruft, sind nur zwei von so vielen Schnitzern innerhalb der inhärenten Logik des Streifens, dass seine Oberfläche gespickt ist von Einkerbungen mehrerer wildgewordener Katzentatzen. Dass Kelich und Konsorten in dem inflationär erwähnten HAZ-Interview ihr Schaffen dann noch dezidiert in den Dunstkreis von wahren Transgressiven und Subversiven des abseitigen Kinos, wie sie das Horror-Kino der 80er bereichert haben, zu stellen versuchen, bringt das Fass zum Überlaufen, und man möchte ihnen gerne persönlich mitteilen: SACERDOS mag ihnen viel Spaß beim Drehen bereitet haben, und manchen schlichten Gemütern (wie mir) beim Schauen ebenfalls eine vergnügliche Stunde verschaffen, aber verglichen mit dem Splatter-Oeuvre des ebenfalls inflationär erwähnten Signore Fulci ist ihr Film ungefähr das, was ein Gerangel auf einer Dorfkirmes im Vergleich mit einer nationenübergreifenden, Köpfe rollenlassenden, regimestürzenden Revolution wäre.

Abb.4: Partei-Placement galore: Wo bekomme ich nur diesen stylischen SPD-Toaster her?
Wenn ich nun noch anfüge, dass unsere SPD-Splatter-Freaks neben SACERDOS seit den mittleren 2000ern noch etliche Kurzfilme inszeniert haben, die sich quer durch sämtliche Genres schlängeln - darunter HEIMATERDE über eine Geheimloge, die im Namen des völkischen Dichters Hermann Löns Frauen entführt, Doktoranden bedroht und okkulte Zeremonielle durchführt, eine Art Mini-Sitcom namens ZWEI BÄRENSTARKE SOZIS, das BLAIR-WITCH-Derivat VERLASSENE SEELEN oder das Drama AUSGESCHLOSSEN über die individuelle Isolation innerhalb der modernen Gesellschaft - kann man vielleicht ansatzweise ermessen, auf was für ein Wrack ich hier gestoßen, in dessen Rumpf nicht unbedingt ein Schatz warten muss.
Über den SPD-Toaster indes komme ich noch immer nicht hinweg...






























