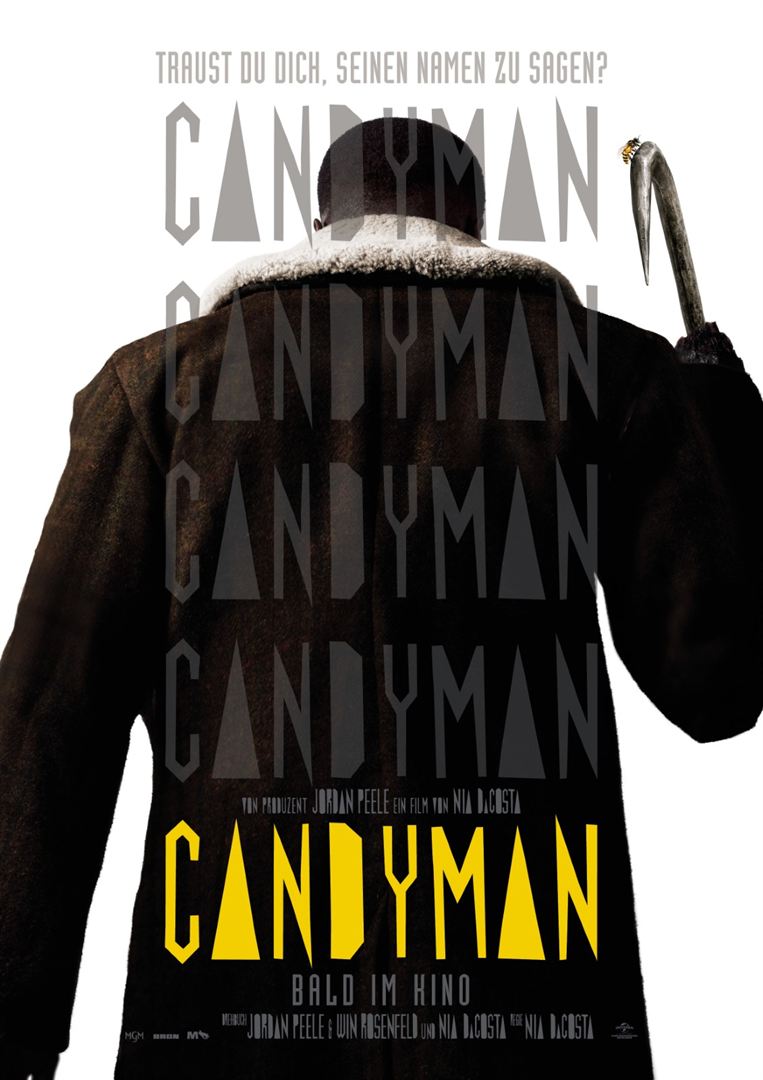The Suicide Squad
„We're all going to die…”
Nach US-Regisseur David Ayers etwas glückloser Erstverfilmung der DC-„Suicide Squad“-Antihelden-Comics aus dem Jahre 2016 trat, nach einigem konzeptionellen und personellen Neuausrichtungen sowie dem zwischengeschobenen
Spin-Off „Birds of Prey“, der von Marvel bzw. Mutterkonzern Disney geschasste US-Filmemacher James Gunn („Slither“, „Guardians of the Galaxy“) an, es noch einmal zu wagen: Im Gegensatz zu Ayer, der es seinerzeit zu vielen Interessengruppen auf Produzentendruck hin hatte recht machen müssen und das kreative Potential des Stoffs daher nicht ausschöpfen konnte, ließ man Gunn weitestgehend freie Hand – und kurzerhand das Drehbuch selbst verfassen, wie er es zur Bedingung gemacht hatte. Die, um einen Artikel erweitert, nun „The Suicide Squad“ betitelte Science-Fiction-Fantasy-Action-
Splatter-Big-Budget-Trash-Komödie (uff…) kam im Sommer 2021 in die Kinos und wurde zum Reboot erklärt, obwohl dieser elfte Film des
DC Extended Universe auch als Fortsetzung fungieren hätte können.
„This is suicide.” – „Well, that's kind of our thing.“
Im südamerikanischen Inselstaat Corto Maltese hat ein Militärputsch das einst von den USA installierte Regime gestürzt. Um alle Informationen über das in der dortigen Geheimbasis Jotunheim stationierte Geheimprojekt „Starfish“ – eine intergalaktische Geheimwaffe – zu vernichten, stellt Amanda Waller (Viola Davis, „Blackhat“) eine Gruppe Strafgefangener zusammen und schickt diese auf die Insel. Sind Colonel Rick Flag (Joel Kinnaman, „Verblendung“), Harley Quinn (Margot Robbie, „Birds of Prey“), Captain Boomerang (Jai Courtney, „Terminator – Genisys“), Blackguard (Pete Davidson, „Dating Queen“), Weasel (James Gunns Bruder Sean Gunn, „Super - Shut Up Crime!“), T.D.K. (Nathan Fillion, „Der Soldat James Ryan“), Javelin (Flula Borg, „Killing Hasselhoff“), Mongal (Mayling Ng, „Lady Bloodfight“) und Savant (Michael Rooker, „Henry - Portrait of a Serial Killer“) erfolgreich, winkt Hafterleichterung – doch desertieren sie, bläst Waller ihnen per in den Nacken installierter Sprengvorrichtung ferngesteuert die Rüben weg. Diese Schwadron jedoch ist lediglich die Vorhut, Kanonenfutter, das den Feind von der Landung der eigentlichen Elitetruppe ablenken soll. Die beiden Profikiller und Ex-Soldaten Bloodsport (Idris Elba, „28 Weeks Later“) und der für den „Weltfrieden“ bereitwillig über alle Leichen gehende Peacemaker (Ex-Wrestler John Cena, „Bumblebee“), der bunte Punkte schießende und erbrechende Polka-Dot Man mit ausgeprägtem Mutterkomplex (David Dastmalchian, „Blade Runner 2049“), die Rattenherrscherin Ratcatcher II (Daniela Melchior, „The Black Book of Father Dinis“) und der etwas tumbe, dafür umso gefräßigere und starke Nachkomme einer Meeresgottheit, King Shark (Steve Agee, „Super – Shut Up Crime!“, im Original von Sylvester Stallone gesprochen), bilden das Sträflings-Team „Task Force X“, das sich nun neben Diktator Silvio Luna (Juan Diego Botto, „Lifeline“) und dessen Truppen auch dem Folterknecht Thinker (Peter Capaldi, „World War Z“) und dem „Project Starfish“ ausgesetzt sieht, dessen ganze Ausmaße ihm erst nach und nach bewusst werden…
„He's not a werewolf, he's a weasel! He's harmless! I mean, he's not harmless, he's killed 27 children, but, you know...“
Was in vergangenen Jahrzehnten noch eines der größten Probleme von Superhelden-Comicverfilmungen war, die halbwegs glaubwürdige Darstellung ihrer Superkräfte und die daraus resultierende Action, ist dank immer ausgefeilter und realistischer anmutender
CGI und anderer Spezialeffekte längst möglich. Kommt kein echtes Comic-Gefühl auf, hat das andere Gründe. Was für Superhelden gilt, besitzt natürlich auch für Antisuperhelden Gültigkeit, und so bietet bereits der Prolog ein ganzes Potpourri an Ultrabrutalem und Action, das an Kriegsfilme à la „Der Soldat James Ryan“ erinnert. Auf den Vorspann folgt eine Rückblende, bevor es in die Gegenwart geht. Zeit- und Ortsangaben zur Orientierung werden künstlerisch mittels Bildinhaltselementen dargestellt und helfen, sich in den immer mal wieder installierten Rückblenden, insbesondere zu parallel stattgefundenen Ereignissen, zurechtzufinden. Mit einer absichtlich sprunghaften und unzuverlässigen Narration wie noch bei „Birds of Prey“ hat das aber nicht viel zu tun; es erzeugt eine eigene, angenehme Dynamik, die sich gut in die Dramaturgie einfügt.
„I don't like to kill people, but if I pretend they're my mom, it's easy.”
Eben diese Dramaturgie steckt voller Überraschungen und wird zu keiner Sekunde langatmig. Als Beispiel sei die zu einem betont übertrieben lässig-zynischen Mordballett avancierende Ankunft der Schwadron in einem cortomaltesischen Dorf angeführt, die zunächst wenig schöne Assoziationen an revisionistische US-Vietnamfilme weckt. Aber, siehe da: Man hat mir nichts, dir nichts versehentlich die verbündeten Rebellen getötet! Dadurch gerät diese Sequenz zur Verballhornung faschistoider Söldnerfilme. Die fiktionale Insel, ehrerbietend benannt nach dem Protagonisten der italienischen Abenteuer-Comics von Zeichner Hugo Pratt, erinnert mal an Kuba, mal an Venezuela – aber später stellt sich heraus, dass die USA weit mehr Dreck am Stecken haben als die Corto-Malteser. Der Seitenhieb auf die kriegerische US- bzw.
NATO-Regime-Change-Außenpolitik ist nicht zu übersehen.
James Gunn beweist auch einmal mehr ein feines Gespür für seine Figuren, macht sie zu Charakteren, wozu neben seiner Erfahrung im Antihelden-Comicfilm beigetragen haben mag, dass er mit diversen Schauspielern bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat. Wer es schafft, die Handlung lang genug zu überleben, erhält etwas Zeit für seine Hintergrundgeschichte oder auch für introvertiertere, stillere Momente, die Gunn kitschfrei inklusive harschen Brechungen zu inszenieren versteht. Ratcatcher IIs traurige Vita wird in Form einer in Busfensterscheiben visualisierten Rückblende gezeigt, was nur eines von mehreren Beispielen für die kreative Kameraarbeit und visuelle Gestaltung des Films ist. Die Rattenherrscherin entwickelt dann auch eine besondere Beziehung zu Bloodsport, der unter einer ausgemachten Rattenphobie leidet (was Anlass für
Running Gags ist). Der Polka-Dot Man hingegen bleibt auch mit seinem Mutterkomplex skurril und komisch, wenn Gunn verbildlicht, wie all seine Mitmenschen für ihn wie seine Mutter aussehen. Selbst der per
Motion Capture auf die Leinwand gebrachte King Shark bekommt einen leisen Moment, wenn er bunte Fische in einem riesigen Aquarium erspäht und mit ihnen zu spielen beginnt.
Als das ändert indes nichts daran, dass King Shark eine witzig-tumbe Erscheinung ist, zahlreiche Superhelden-Klischees verballhornt werden und die oft amüsanten Sprüche und Dialoge vor vulgären, eigentlich kaum jugendfreien Vulgarismen, wie man sie von Marvel & Co. eben kaum kennt, regelrecht strotzen – ganz gleich ob untereinander oder im Disput mit der eigenen minderjährigen Tochter, die eine „Fernsehuhr“ stibitzt hat. Harley Quinn ist diesmal tatsächlich nur eine Figur von vielen, hat dementsprechend weniger Leinwandpräsenz und zeigt weit weniger Haut als die männlichen Darsteller. Starke Auftritte hat sie zweifelsohne dennoch, allen voran ihre Diktatorenromanze, die auch als in sich abgeschlossener Kurzfilm bestens funktioniert hätte. Prinzipiell auch nicht zu verachten ist ihr für die Gegenseite verlustreicher Gefängnisausbruch, dessen Brutalität Gunn mit niedlichen Zeichentrickelementen konterkariert. Störend wird das den Figuren per Drehbuch auferlegte Verhalten jedoch in ein paar (wenigen) Szenen, in denen sie nichtfigurenimmanente Kräfte zu entwickeln scheinen, die sie die größten Gefahren wie z.B. dichten Kugelhagel blessurenfrei überstehen lassen – da scheint dann aller Ironisierung zum Trotz doch immer mal wieder typischer Actionkino-
One-(Wo)Man-Army-Quatsch durch.
„Oh my god, we've got a freaking kaiju up in this shit!”
Eine ganze Seestern-Armee hingegen ist Endgegner Starro, ein überdimensionaler Seestern aus dem All, der kleinere Exemplare seiner selbst auf Mensch abschießt, die sich auf ihren Köpfen festsetzen und diese damit zu seinen verlängerten Armen machen. Was man leichtfertig als „Alien“-Reminiszenz erachten könnte, ist tatsächlich eine uralte DC-Eigenkreation: In den Comics kämpfte die Justice League bereits 1960 gegen das Ungeheuer, das seither immer mal wieder auftauchte und zweifelsohne einen der bizarrsten Widersacher des DC-Multiversums darstellt. Und selbst diese Kreatur erhält noch eine tragische Note. Das im
Kaiju-Stil à la Godzilla und Konsorten inszenierte Finale ist Japan-Monster-Hommage und bombastische Action- und Zerstörungsorgie zugleich. Wie zur Hölle Bloodsport auf einer Festplatte gespeicherte sensible Daten mitten im Trubel so ohne weiteres auf einen sicheren Server hochgeladen hat, hätte aber schon einer Erklärung bedurft. Hat er in seinem Anzug ein Rechenzentrum…?
„I was happy in space, looking at the stars...”
Suicide-Squad- und Batman-Comicautor John Ostrander hat einen Gastauftritt als Dr. Fitzgibbon, Troma-Chef Lloyd Kaufman und Schauspielerin Pom Klementieff („Guardians of the Galaxy Vol. 2“) tanzen in einem Nachtclub. Und mit Kaleidoscope (Natalia Safran, „Aquaman“), Calendar Man (ebenfalls Sean Gunn) und Double Down (Jared Leland Gore, „Boss Level“) sind für entsprechend geeichte Fans weitere DC-Schurken kurz zu erhaschen. Gerade letzteres ist ein Indiz für die Liebe zum Detail, mit der James Gunn arbeitete. Die musikalische Untermalung vereint Steven Prices
Score mit einer überraschend stimmigen Melange aus Pop und Rock sowie Hip-Hop und R&B bekannter und unbekannterer Interpreten, die sowohl Klassiker als auch jüngere Songs umfasst, darunter interessante Coverversionen. Schauspielerisch die größte Entdeckung ist die gebürtige Portugiesin Daniela Melchior, die sich mit ihrer Darstellung der Ratcatcher II für weitere Produktionen empfohlen haben dürfte.
Ich kenne die Comics nicht, auf denen die „Suicide Squad“-Filme basieren, aber James Gunn ist ein comichaft anarchischer Straßenfeger gelungen, der den Comic-Nerd genauso ansprechen sollte wie den
B-Movie- und
Trash-Fan, den/die Action-Liebhaber(in) oder den
Splatter-Freak (hier platzt manch Schädel, werden Menschen auseinandergerissen etc.), vielleicht sogar Freundinnen und Freunde von Verschwörungsthrillern. Im Post-Finale werden moralische Fragen verhandelt, die einmal mehr US-Geheimdienste und -Staatsführung adressieren und dazu beitragen, dass „The Suicide Squad“ gefühlt alles, was von den 1950ern bis in die Gegenwart Spaß gemacht hat, miteinander verbindet, ohne dabei beliebig zu werden oder jeglichen Anspruch aufzugeben. Damit spielt er tatsächlich in einer anderen Liga als noch die 2016er-Version, wenngleich er – wie eingangs erwähnt – mühelos auch als Fortsetzung durchgegangen wäre, nicht zuletzt wegen der zahlreichen personellen Überschneidungen. Ein bisschen schade ist es schon, dass er nicht den coolen Titel „Suicide Squad: Project Starfish“ bekam. Davon unabhängig sind bereits die auf oldschool getrimmten Kinoplakate echte Hingucker und werden sicherlich bald die Wände des einen oder anderen Comic-Fans zieren.
Wer übrigens im Kino zu früh aufsteht oder auf dem heimischen Sofa die Stop-Taste betätigt, verpasst die
Post-Credit-Szene, die einen Hinweis darauf gibt, wie es in Sachen
DC Extended Universe weitergeht...