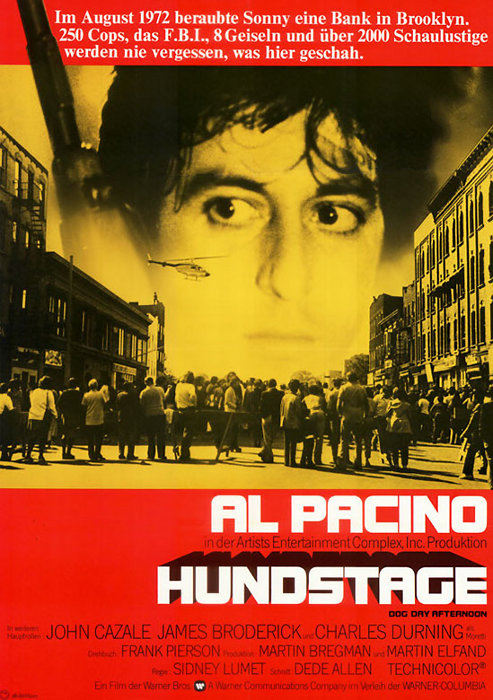Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt
Verfasst: Mi 27. Apr 2011, 21:23

Navajo Joe (Kopfgeld: Ein Dollar)
„Das amerikanische Gesetz muss von Amerikanern geschützt werden!“ – „Mein Vater wurde hier geboren, der Vater meines Vaters, genauso der Vater vom Vater meines Vaters wurde hier geboren. Wo ist dein Vater geboren?“ – „In Schottland.“ – „Dann bist du kein Amerikaner!“Eine Bande von Halunken zieht durch die nach wie vor unbesiedelteren Regionen der Vereinigten Staaten und versucht, durch den Mord an Indianern und den Verkauf von deren Skalps Geld zu verdienen. Hinter ihnen her ist jedoch ein junger Indianer (Burt Reynolds), der einen nach dem anderen umbringt. Als die Verbrecher einen größeren Coup planen und durchführen, stiehlt Navajo Joe die Beute, einen Zug mit einer halben Million US-Dollar an Bord, und bringt ihn an den ursprünglichen Bestimmungsort. Dort bietet er den Stadtbewohnern seine Hilfe gegen die skrupellose Bande an.
Sergio Corbuccis Italo-Western „Navajo Joe“, in Deutschland auch bekannt als „Kopfgeld: Ein Dollar“, erschien 1966 zwischen seinen großen Genreklassikern „Django“ und „Leichen pflastern seinen Weg“ und trägt unverkennbar deren Handschrift. Unterstützt von den später berüchtigten Italo-Regisseuren Ruggero Deodato („Cannibal Holocaust“) und Fernando Di Leo („Milano Kaliber 9“) und gesegnet mit einem fantastischen Morricone-Soundtrack, lässt man den seinerzeit noch unbekannten, aber athletischen und stunterfahrenen US-Darsteller Burt Reynold als indianischen Rächer Jagd auf eine skrupellose, ausgerechnet von einem Halbblut angeführte Kopfgeldjägerbande machen. Die Jäger werden also zu Gejagten, doch die feige Stadtbevölkerung, der die Bande 500.000 Dollar stehlen will, schaut bis auf wenige Ausnahmen tatenlos zu.
Corbuccis „Navajo Joe“ ist eine ruppige, wütende, hass- und gewalterfüllte Abrechnung mit dem US-amerikanischen Völkermord an den Ureinwohnern, mit erbärmlichem Rassismus und bigotter Feigheit. Der Film zählte zu den ersten seiner Gattung, die einen Indianer als „Helden“ einsetzten und dürfte daher eine handfeste Provokation gegenüber dem verklärenden, die Indianer als unzivilisierte und hundsgemeine Wilde darstellenden US-Western gewesen sein. Von der ersten Minute an ist die Marschrichtung klar; „Navajo Joe“ beginnt mit der hinterhältigen Ermordung und anschließender Skalpierung einer unschuldigen Indianerin. Subtilität ist Corbuccis Sache nicht, er kommt ungeschönt auf den Punkt und sucht (und findet) die direkte Konfrontation mit dem Zuschauer. Dabei bleibt natürlich die Sorgfalt und Brillanz, die sein Namensvetter Leone jeder einzelnen Einstellung zukommen ließ und dadurch epische Bilderwelten erschuf, etwas auf der Strecke, dafür ist aber das Tempo hoch, der Bodycount rekordverdächtig und das Finale herrlich tragisch und pathosgetränkt.
Der zu einem dunkleren Teint geschminkte Reynolds, durch den ironischerweise tatsächlich auch indianisches Blut fließt, macht bei all dem eine gute Figur, Aldo Sambrell gibt einen herrlich fiesen Bösewicht ab und Nicoletta Machiavelli verzaubert den Zuschauer als wunderschöne Estella. Wie auch der Schweigsame aus „Leichen pflastern seinen Weg“ bietet Navajo Joe seine Hilfe nicht uneigennützig; die wahren Beweggründe erfährt man erst spät, sie sind aber keinesfalls überraschend. Der große „Aha-Effekt“ bleibt also aus, der Stoff ist sozusagen einerseits revolutionär, andererseits aber in gewisser Hinsicht Rache-Western-typisch konventionell – was dem Unterhaltungswert aber keinen Abbruch tut. Das tun eher die hin und wieder doch arg unrealistischen Szenen, in denen Joe von einer Art Schutzfeld umgeben scheint, das ihn auch den größten Kugelhagel unbeschadet überstehen lässt. Zudem werden vermutlich manch tierliebem Zuschauer die Pferde leid tun, die ohne Rücksicht auf Verluste die schlimmsten Stürze über sich ergehen lassen mussten und es wenig verwunderlich wäre, wenn sie zu Dutzenden ihr Leben für diesen Film gelassen hätten. Sicherlich, das ist bestimmt in vielen Western so, hier ist es mir aber aus irgendeinem Grund ganz besonders aufgefallen.
Neben der zynischen Brutalität und Kaltblütigkeit der Hauptgrund, weshalb mir „Navajo Joe“ wie das Bindeglied zwischen „Django“ und „Leichen pflastern seinen Weg“ erscheint, ist (Achtung, Spoiler!) der Umstand, dass
► Text zeigen
Fazit: Ein (nicht nur filmhistorisch) wichtiges, aussagekräftiges Statement in dreckiger Italo-Western-Manier, keinesfalls perfekt, aber unbedingt sehenswert.