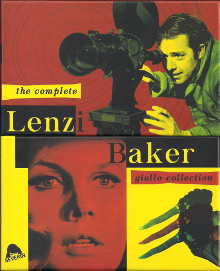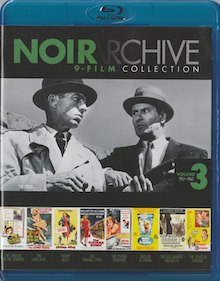The spook who sat by the door (Ivan Dixon, 1973) 7/10

- In den Tiefen des Internets begraben.jpg (7.4 KiB) 290 mal betrachtet
Senator Hennington steht kurz davor, nicht mehr wiedergewählt zu werden. Eine Katastrophe! Um sein Image bei der schwarzen Bevölkerung zu heben und damit die benötigten Stimmen zu bekommen, initiiert er die Ausbildung der ersten afro-amerikanischen CIA-Agenten der Weltgeschichte. Abgang Senator Hennington, Auftritt Agent Freeman. Dan Freeman ist der einzige der Anwärter, der die Ausbildung bis zum Ende durchhält, und wird somit tatsächlich der erste schwarze CIA-Agent der Welt. Als Belohnung bekommt er den Job als Sektionschef. Der Kopierabteilung. Freeman hat immerhin den Ehrgeiz, der beste Kopierabteilungssektionschef jemals zu werden, doch als er eines Tages eine Gruppe Besucher herumführen soll, flüstert einer der Gäste seinem Vorgesetzten zu, wie toll der Mann doch integriert sei. Was für eine Idee! Wir setzen den schwarzen Mann in die Eingangshalle und alle sehen, wie vorbildlich wir integrieren!!
Freeman, allein der Name ist ja bereits Programm, macht diesem Unfug ein Ende indem er kündigt und eine Stelle als Sozialarbeiter in seiner Heimatstadt Chicago annimmt. Zumindest tut er so als ob, aber in Wirklichkeit rekrutiert er schwarze Drogendealer, denen er seine eigene Ausbildung angedeihen lässt. Freemann bildet seine Brüder in Nahkampf, Sprengstoff- und Waffenkunde und allerlei konspirativen Techniken aus, und baut sich so innerhalb kürzester Zeit eine schwarze Untergrundarmee auf. Sein Ziel ist, die Vorherrschaft des weißen Mannes zu beenden, und er ist intelligent und skrupellos genug um zu wissen, dass dies nur mit Waffengewalt geschehen kann. Schlussendlich ist Freeman der Anführer einer Guerillaorganisation in Südwest-Chicago, die den Weißen so richtig einheizt. Taktisch geschult, mit militärischer Bewaffnung und gut strukturiert, sind die Männer Nationalgarde und Militär komplett überlegen.


Nach den wenigen Besprechungen im Internet zu urteilen war ich auf eine Satire gefasst, die sich darüber lustig macht was der weiße Mann denn wohl unter Integration verstehen mag. Das erste Drittel, die Ausbildung Freemans, ist auch durchaus mit satirischen Spitzen versehen, widmet sich aber eher der langsamen und soliden Vorstellung Freemans: Ein hochintelligenter und gründlicher Mann, der einen Plan hat, für dessen Umsetzung er sich die benötigte Zeit nimmt, und den er nicht irgendwelchen Sticheleien angeblicher Brüder oder tatsächlicher Rassisten opfert. Freeman geht seinen Weg, und wenn man sich als Zuschauer durch das erste, mitunter manchmal etwas zähe, Drittel durchgekaut hat, nimmt die Geschichte mit der Ankunft in Chicago schnell Fahrt auf. Die Ideen und Absichten Freemans werden klar, seine Freundschaften zu einer Washingtoner Hure und einem örtlichen Polizeiinspektor ergeben allmählich Sinn, und spätestens wenn die ersten paramilitärischen Aktionen laufen, beginnt der Bildschirm schnell zu brennen.
Was ab diesem Zeitpunkt kommt ist keine Satire mehr und kein billig produzierter Schwafelfilm, sondern ernstgemeintes Actionkino der Art
Brüder bewaffnet euch und kämpft gegen die Unterdrücker!. Tatsächlich gibt SPOOK eine recht genaue Vorstellung davon, wie der bewaffnete Kampf gegen den Rassismus erfolgreich in die Städte getragen werden kann. Aus heutiger Sicht ein cineastisches Unding, propagiert SPOOK allen Ernstes den Einsatz einer Stadtguerilla gegen die weiße Oberschicht. Und Polizist Dawson, immerhin der beste Freund Freemans, der sich für die weißen Herren verdingt und deren Drecksarbeit macht, hat dann auch ein entsprechendes Schicksal, dass man sich eigentlich recht schnell ausmalen kann.


Nein, spätestens die zweite Hälfte des Films bietet einige unerquickliche Szenen. Die Aufstände gegen die Cops, die den schwarzen Jugendlichen erschossen haben, und als Antwort auf die wütenden aber friedlichen Proteste mit abgerichteten Hunden in die Menge gehen, und damit die Stimmung erst zum Umkippen bringen, diese Aufstände gehen trotz des offensichtlichen Minimalbudgets beim Dreh tief unter die Haut, und erzeugen im Jahr 2021 die gleiche Wut und Aggression gegen den weißen Herrenmenschen wie 1967 in Detroit oder 1992 in Los Angeles. Oder 2014 in Ferguson, Missouri. Oder oder oder …
Dabei setzt SPOOK nicht auf eine durchgehend realistische Atmosphäre wie zum Beispiel Kathryn Bigelows unter die Haut gehender Film DETROIT, sondern agiert bewusst (und sicher auch budgetbedingt) als Spielfilm, der vor allem zu Beginn ausschließlich im Studio gedreht wurde. Gleichzeitig vermeidet Regisseur Ivan Dixon aber auch jegliches exploitative Element, und will sich ganz offensichtlich bewusst vom erfolgreichen Blaxploitation-Kino dieser Jahre abgrenzen. SPOOK ist ernstgemeintes Black Cinema mit einer himmelstürmenden Aussage und vor allem gegen Ende hin mächtig Wumms in den Knochen. Dass er dabei oft relativ dialoglastig und trocken daherkommt, weil Freeman selber seine Gedanken halt nunmal mit Worten vorbringt anstatt mit den Fäusten, bremst SPOOK zwar an der ein oder anderen Stelle aus, bietet aber gleichzeitig eine angenehme Abwechslung zu den parallel agierenden SHAFT- und FOXY BROWN-Superhelden. Und es lohnt sich auf jeden Fall, innerhalb der Dialoge auf die kleinen Spitzen zu hören; ich bin mir zum Beispiel sicher, dass der Name des Berater des Generals, Carstairs, kein Zufall ist – Der Name kann auch problemlos wie Custer gesprochen werden. Und eben dieser Custer, nein Carstairs, redet auch einmal aus Versehen von Konzentrations-, nein Entschuldigung, natürlich von Sammellagern für die farbige Ghettobevölkerung. Übrigens auch sonst eine bemerkenswerte Erklärung, warum das Ghetto nicht einfach hermetisch abgeriegelt werden kann um die Guerilla auszutrocknen:
We sealed off the ghetto for three days last week – It paralyzes the city. Chicago is more dependent on black labour than one will think. 90 % of the garbage collectors are coloured. 60 % of the hospital workers are coloured,. 60 % of the bus drivers and 80 % of the postal workers. Wenn diese Zahlen heute mal einem militanten Minderheitenführer in die Finger fallen würden, könnte sich die Situation der Schwarzen in den USA aber ganz schnell ändern. Und die Sache mit den friedlichen Straßen ebenfalls …
Ich kann jedem zeithistorisch und politisch Interessiertem nur wärmstens empfehlen, auf die Suche nach diesem Streifen zu gehen. Hochgradig lohnend, und sei es nur wegen des Moments, wenn zwei hartgesottene Untergrundkämpfer eine tragische Situation eines klassischen Onkel Tom-Films nachspielen. Ein Lachtränengarant, wenn es nicht so traurig wäre …
Der Sieg des Kapitalismus ist die endgültige Niederlage des Lebens.
(Bert Rebhandl)