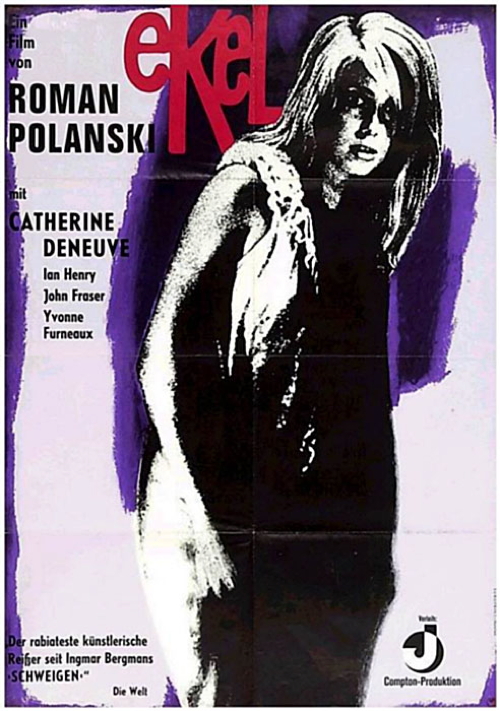Xmas Tale
„Ich komm mit zur dir und leih mir ‚Zombie Invasion’ aus!“ – „Der Film ist leider weg...“ . „Du hast mir doch gesagt, du hättest ihn!“ – „Meine Mutter hat ihn leider gelöscht, weil sie ‚Reich & schön’ aufgenommen hat.“ – „So eine blöde Kuh...“Eine Gruppe von fünf Kindern findet kurz vor Weihnachten in einem Loch im Wald eine Frau in einem Weihnachtsmannkostüm. Wie es sich herausstellt, handelt es sich um eine skrupellose Einbrecherin, die im Besitz von zwei Millionen Peseten befindet. Die Kinder beschließen, die Frau nur gegen die Herausgabe des Geldes freizulassen und lassen sie in dem Loch hungern. Als sie es schließlich haben, stirbt die Frau aber kurzfristig. Dummerweise haben zwei der Jungen jedoch an der Frau ein Voodooritual vollzogen, das sie aus Horrorfilmen kennen und die Einbrecherin kehrt als axtbewehrte Untote zurück, um Rache zu nehmen. Es kommt zu einem Showdown in einem stillgelegten Freizeitpark...
Nach seinen Genrebeiträgen „Second Name“ und „Romasanta“ beteiligte sich auch Regisseur Paco Plaza an der sechsteiligen, spanischen TV-Horrorfilm-Reihe aus dem Jahre 2006 und erschuf mit „Xmas Tale“ das genaue Gegenteil von Weihnachtskitsch und eine Hommage an die glorreichen 1980er.
Denn „Xmas Tale“ spielt Mitte der 80er und die fünf Kiddies, um die sich der Film dreht, sind fasziniert von den Ekeleffekten splatteriger Zombiestreifen wie dem „Film im Film“ „Zombie Invasion“, spielen das „A-Team“ nach und begeistern sich für „Martschl Arts“ à la „Karate Kid“. Der Film richtet sich somit an eine Zielgruppe, die seinerzeit etwa im gleichen Alter war und ähnliche Erinnerungen an jene Dekade hat. Zur Weihnachtszeit findet unser Möchtegern-A-Team eine Bankräuberin im Weihnachtsmannkostüm, die auf ihrer Flucht in ein Loch im Wald gefallen ist und ohne fremde Hilfe dort nicht mehr herauskommt. Als sie realisieren, mit wem sie es da zu tun haben, bewahrheitet sich die alte Erkenntnis, wie grausam Kinder sein können: Nicht nur, dass sie die Bankräuberin erpressen und foltern, um an ihre Beute heranzukommen, ein Teil der Gruppe spielt mit ihr auch noch das Zombieritual aus dem Film „Zombie Invasion“ nach. Ist die Gaunerin nach Tagen des schwerverletzt im Loch Dahinvegetierens tatsächlich gestorben und macht nun zombifiziert und axtschwingend Jagd auf ihre minderjährigen Peiniger?
Die Grenzen zwischen kindlich-sympathischem Spiel und bitterem Ernst verwischen, die Kinder agieren erschreckend kaltblütig und abgebrüht, von Weihnachtsversöhnlichkeit o.ä. nicht die geringste Spur. Inwieweit sie sich dessen, was sie tun, bewusst sind, ist nicht ganz klar – kindliche Abenteuerlust und Neugierde treffen auf emotionale Verrohung, Erwachsene kommen, von der Bankräuberin abgesehen, nur am Rande vor. Lediglich die kleine Moni scheint ernsthafte Gewissensbisse zu entwickeln und wird dafür von den schlimmsten Satansbraten ihrer Clique verachtet.
Die Kurzen werden allesamt klasse von ambitionierten Jungdarstellern gespielt und tragen mitsamt ihren Charakterzeichnungen einen Großteil zum Gelingen dieser rabenschwarzen Komödie bei. Unter der Oberfläche vergnügt spielender Kinder kommen tiefe (un)menschliche Abgründe wie Skrupellosigkeit, Respektlosigkeit vor dem Leben und Geldgier zum Vorschein. Doch „Xmas Tale“ moralisiert nie offen, sondern bleibt stets seinem komödiantischen Stil treu. Das wirkt mitunter ziemlich bizarr, aber eben auch unterhaltsam und interessant. Ob Plaza damit das Gegenteil von Urbizus vorausgegangenem Beitrag „A Real Friend“ erreichen, nämlich Horror- und Actionunterhaltung verantwortlich für die moralische Verwahrlosung und Abstumpfung der Kinder machen will, wage ich zu bezweifeln, evtl. wollte er die ja in unschöner Regelmäßigkeit immer wieder aufflammende Jugendschutz-Hysterie auf die Spitze treiben und karikieren, indem er sie nur scheinbar aufgreift und zum Anlass für einen eigenen Film nimmt, der im Finale selbst mit einigen blutigen Effekten auftrumpft. Die Ignoranz der Erwachsenenwelt den Kindern gegenüber, dargestellt beispielsweise durch ihr fast völliges Fehlen in diesem Film, halte ich für den wahrscheinlicheren Adressaten von Plazas Kritik. Interessanter Kamerakniff: Beim Auftauchen eines Polizisten wird die kindliche Perspektive beibehalten, so dass nie sein Gesicht, sondern er lediglich von der Hüfte an abwärts zu sehen ist (was mich an die Nanny aus den „Muppet Babies“ erinnerte).
Soviel Spaß „Xmas Tale“ dem 80er-philen Zuschauer auch bereitet, bis zum rasanten, actionreichen und die schwarze Komödie mit einer bitterbösen Pointe versehenden Finale, das die Frage nach der Zombiewerdung der Bankräuberin aus meiner Sicht beantwortet, schleichen sich trotz geringer Spielzeit einige Längen ein. Das ist schade und hätte so nicht sein müssen, grundsätzliches genügend kreatives Potential, inszenatorisches Talent und Gespür für Humor hat Plaza schließlich bewiesen. Zudem hat man es sich mit der zwischenzeitlich Fürtoterklärung der Bankräuberin meines Erachtens etwas zu einfach gemacht und ich bin mir nicht sicher, ob die Schlusspointe dadurch bei allen Zuschauer funktioniert. Hier wäre ausnahmsweise etwas mehr Eindeutigkeit durchaus angebracht gewesen.
Ich gebe mal vorsichtige sechseinhalb Punkte, gestehe „Xmas Tale“ aber noch Luft nach oben zu. Mal sehen, was eine Zweitsichtung beizeiten ergeben wird.