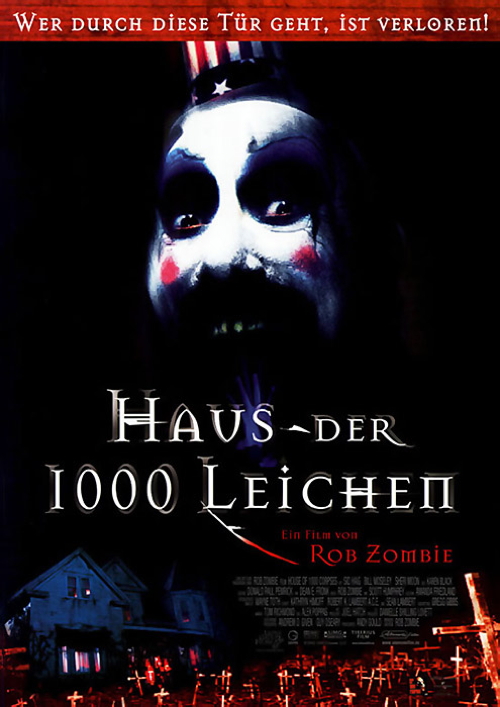Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt
Verfasst: Fr 30. Aug 2013, 00:38

Sid & Nancy
„Sidney ist mehr als nur ein normaler Bassist, er ist das absolute Desaster! Er ist ein Symbol, eine Metapher! Er verkörpert die ganze Dimension der nihilistischen Generation!“ (Malcolm McLaren)Sid Vicious (Gary Oldman), legendärer Gitarrist der Sex Pistols und seine Beziehung zu der Punkerin Nancy Spungen (Chloe Webb) sind das Thema dieses Films. Als sich die Punkband nach einer Amerikatournee 1977 auflöst, versucht sich Vicious an einer Solo-Karriere, doch seine Heroinsucht ist ihm im Weg. Eines Morgens erwacht er und findet Nancy ermordet auf. Der Verdacht fällt auf ihn...
Mit seinem zweiten Film in Spielfilmlänge inszenierte und interpretierte der britische Regisseur Alex Cox („Repo Man“) im Jahre 1986 die Geschichte der fatalen Liebe zwischen dem Bassisten der legendären Punkband „The Sex Pistols“, der sich selbst Sid Vicious nannte, und seiner Lebensgefährtin Nancy Spungen.
Sid Vicious ersetzte im Februar 1977 Glen Matlock als Bassist bei den Sex Pistols und ging mit ihnen auf US-Tournee. Nach der überraschenden Auflösung der Band Anfang 1978 arbeitete Vicious an einer Solokarriere. Während dieser Zeit pflegte er eine von Drogenabhängigkeit und zunehmender Gewalt geprägte Liebesbeziehung zur US-Amerikanerin Nancy Spungen, die zuvor als Groupie in Erscheinung getreten war. Im Oktober 1978 wurde Nancy Spungen erstochen in einem New Yorker Hotelzimmer aufgefunden, in Anwesenheit des mit Drogen zugedröhnten Sid Vicious. Er wurde wegen Mordverdachts festgenommen, jedoch gegen eine von seiner Plattenfirma gezahlte Kaution am 01. Februar 1979 vorläufig freigelassen. Nur einen Tag später starb er im selben Hotel an einer Überdosis Drogen. Der Film skizziert diese Ereignisse nach.
„Keiner von uns fickt! Sex ist grässlich!“
Um John Simon Ritchie alias Sid Vicious rankt sich manch Mythos und Legendenbildung. Für die einen war er die Inkarnation des Punks schlechthin, der nach den „Lebensmaximen“ Destroy! und Live fast, die young konsequent lebte. Für die anderen war er lediglich ein untalentierter Junkie, der sämtliche fragwürdigen Punkklischees in sich vereinte. Wieder andere sehen seinen Werdegang differenzierter und halten ihn für ein Opfer des Sex-Pistols-Managers Malcolm McLaren für seine Vision einer Ästhetik des Kaputten und/oder seiner drogenabhängigen Freundin zur Befriedigung ihrer Egozentrik: Ein eigentlich recht intelligenter, lebenslustiger junger Mann, der von Band, Musikindustrie und Freundin gnadenlos ausgebeutet und verheizt wurde und der in seiner juvenilen Labilität und Blauäugigkeit nicht viel entgegenzusetzen hatte – man sieht in McLaren den Ausverkäufer des Punk und in Spungen dessen Femme fatale. Dementsprechend unterschiedlich werden nicht nur seine Person, sondern auch seine Band und ihr Umfeld sowie mitunter das gesamte Punk-Phänomen Ende der 1970er bewertet. Harsche Kritik an Alex Cox‘ Interpretation, die auf dem gleichnamigen Buch basieren soll, setzte es dann auch seitens der realen Pendants der im Film vorkommenden Protagonisten, wovon man sich jedoch, nähert man sich diesem Film, nicht beirren lassen und nach mittlerweile so vielen Jahren Abstand unterschiedliche Perspektiven als eben solche akzeptieren sollte.
„Hier läuft nichts mit eurer Freie-Liebe-Hippie-Scheiße!“
„Sid & Nancy“ steigt mit dem Fund der toten Nancy und Sids Verhaftung ein und holt im Anschluss zu einer ausgedehnten und die eigentliche Handlung ausmachenden Rückblende aus. Cox zeigt Sid und Pistols-Sänger Johnny Rotten als auf- und abgedrehte, zerstörungswütige Soziopathen und bedient sich damit bereits vieler Klischees. Wilde, gut gefilmte Konzertaufnahmen sorgen sodann für mehr Authentizität. Nachdem Sid Nancy kennengelernt hat, scheint sie seine selbstzerstörerische Ader verstärkt anzusprechen. Sie bringt ihn schließlich zum Heroin und damit in die Abhängigkeit und in den Drogensumpf aus Elend und Gewalt. Immer wieder zeigt der Film verbriefte Stationen der nur kurzen Sex-Pistols-Karriere wie ihren Bootsauftritt auf der Themse, das berüchtigte TV-Interview mit seinen „schmutzigen Wörtern“ und die ambivalenten US-Auftritte, wohlgemerkt trotz vorhandenen Archivmaterials allesamt für den Film nachgestellt. Gary Oldman („True Romance“) beherrscht die aus Videoüberlieferungen bekannte Mimik Sids und seine Bewegungen überraschend gut, schnell nimmt man ihm seine Rolle ab. Ein Indiz dafür, wie weit Oldmans Identifikation mit seiner Rolle reichte, mag dabei auch die Tatsache sein, dass er sämtliche im Film verwendeten Sex-Pistols- und Vicious-Songs selbst einsang (!), während Originalbassist Glen Matlock beim Einspielen der Stücke half.
Nancy Spungen wird charakterisiert als dauerbreite, aggressive Junkie-Braut, ständig die Grenze zur Hysterie überschreitend und am Stoff anscheinend noch mehr interessiert als an Sid. Die schauspielerische Leistung Chloe Webbs („Ghostbusters 2“) verlangt ihr viel Mut zur Hässlichkeit ab und trotz der Eindimensionalität ihrer Rolle versieht sie diese mit viel Leben und dem gewissen Etwas, das auch in Nancys Person so etwas wie Tragik erkennen lässt. Bizarre Szenen wie Sid mit Nancy und ihrer Familie gemeinsam am Esstisch sitzend sprengen ein wenig den engen, immer mehr auf Sid und Nancy reduzierten Mikrokosmos und sind willkommener Anlass für schrägen Humor, der sich ebenfalls durch den Film zieht, ohne seine Protagonisten über Gebühr der Lächerlichkeit preiszugeben. Dazu zählen auch witzige Details wie Sids Hammer-und-Sichel-T-Shirt, der bekanntermaßen eher zum Swastika-Motiv griff. Eine weitere nette Randnotiz, die von Szenekenntnis Cox‘ zeugt, sind die sich ganz selbstverständlich unters Publikum mischenden Skins. Apropos Randnotiz: Geradezu zu einer verkommen ist die Auflösung der Sex Pistols, die kaum thematisiert wird – möglicherweise bewusst als Indiz für Sids und Nancys suchtbedingte Teilnahmslosigkeit? Sids Solo-Karriere wird wieder näher beleuchtet, der Dreh zum großartigen „My Way“-Videoclip ebenso gezeigt wie Ausschnitte von Konzerten. Während jener schicksalhaften Nacht im Hotel zeigt man zwar den Konflikt zwischen Sid und seiner Nancy, jedoch nicht den Messerstich, der schließlich zum Tod geführt hat. Für sein ebenso trauriges wie tragisches Ende, für das die Rückblende verlassen wird, überlegte man sich einen gelungenen, kreativen Kunstgriff, indem man keinerlei realistische Bilder der Überdosis zeigt, sondern sich einen surrealen, metapherreichen Schluss voll versöhnlicher, schöner Bilder einfallen ließ.
Besondere Aufmerksamkeit gebührt dem Soundtrack des Films, der neben den bereits erwähnten Neueinspielungen Material solch großartiger Künstler wie Joe Strummer, The Pogues und den Circle Jerks enthält. Auch Ex-Sex-Pistole Steve Jones steuerte mit „Pleasure and Pain“ ein Stück bei. Zu den fernöstlich angehauchten Zwischenstücken stelle ich mir zwar eher vor, wie Sid und Nancy nachts durch Chinatown laufen, dennoch tut der Schuss Exotik zwischen den punkrockigen Songs dem Film gut und sorgt für eine eigentümliche Atmosphäre. In seinen Bildern arbeitet Cox mit einigen Zeitlupen und bedient sich ansonsten seines immer etwas offensichtlich-künstlich wirkenden Bildern, die er zeitweise weitestmöglich in die Nähe einen rauen Realismus zu rücken versucht, häufig aber auch das genaue Gegenteil anstrebt und einzelne Momente künstlerisch-perspektivisch auskostet und es damit zu einigen erinnerungswürdigen Aufnahmen bringt. Eine klassische Dramaturgie verfolgt Cox mit seiner losen Erzählweise nicht, wobei ich nicht genau weiß, ob diese bewusst als Stilelement eingesetzt wird oder erzählerisches Unvermögen dafür verantwortlich ist – übermäßig schaden tut sie dem Film jedenfalls nicht. Abstriche machen muss man bei manch Nebenrolle; Andrew Schofield beispielsweise nehme ich den Johnny Rotten nicht ab. Erwähnenswert: In einer kleinen Nebenrolle als „Gretchen“ findet sich die noch unverbrauchte Courtney Love. Insgesamt ist „Sid & Nancy“ eine interessante Aufarbeitung der Thematik, die als mit Vorsicht zu genießendes biographisches Drama ebenso funktioniert wie als szenenahe Momentaufnahme der Rockhistorie, vor allem aber auch als Parabel auf tragische Beziehungen, in denen Jugend, Rebellion, Labilität und Sucht eine unheilvolle Symbiose miteinander eingehen. „Sid & Nancy“ ist emotional, nicht perfekt, permanent zwischen Kunst und Klischee pendelnd – auf seine Weise ganz so wie Punk eben auch.