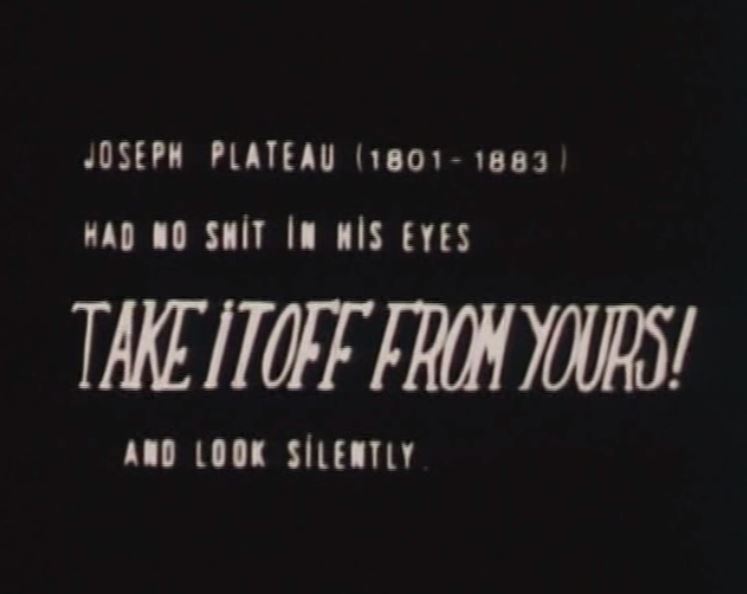Produktionsland: USA 1931
Regie: Tod Browning
Darsteller: Bela Lugosi, Helen Chandler, David Manners, Dwight Frye, Edward Van Sloan, Herbert Bunston,
Frances Dade, Joan Standing, Charles K. Gerrard, Anna Bakacs, Nicholas Bela, Daisy Belmore...
Erster Teil:
Obwohl Universals DRACULA vorgibt, auf im Wesentlichen zwei Vorlagen zu beruhen – nämlich zum einen auf Bram Stokers Roman von 1898 und zum anderen auf der seinerzeit recht erfolgreichen Bühnenfassung von Hamilton Deane, die ab 1924 in England zu sehen war und 1927 in die USA überschiffte, wo sie grundlegend von John L. Balderton bearbeitet worden ist -, fällt jemandem wie mir, der NOSFERATU zu seinen liebsten Filmen überhaupt zählt, natürlich sofort auf, dass Murnaus Grundsteinlegung des Vampirfilmgenres gerade in den ersten zwanzig Minuten von DRACULA viel stärker Pate gestanden hat als die beiden im Vorspann genannten Quellen vermuten lassen. Obwohl die Produzenten von NOSFERATU seinerzeit, was eine der wohl am häufigsten kolportierten Geschichten der Vampirfilmgeschichte ist, darauf verzichteten, sich die Rechte an DRACULA von Stokers Witwe Florence zu verschaffen, und obwohl sie im daraufhin stattfindenden Prozess haushoch verloren, und eigentlich sämtliche Kopien des Films hätten vernichtet werden sollen, hat der es scheinbar doch irgendwie in die Archive der Universal Studios geschafft, denn anders zu erklären sind die teilweise frappierenden Übereinstimmungen zwischen NOSFERATU und DRACULA im Transsilvanien-Teil wohl kaum.
Da ich mich zurzeit intensiv mit Lese- und Schreibszenen im frühen Kino beschäftige, sticht mir gleich die zweite Szene von DRACULA wie eine Nadel ins Auge. Nachdem wir gesehen haben wie eine Kutsche durch eine matte-painting-Karpatenlandschaft fährt, befinden wir uns schon in ihrem Innern, wo eine Dame, bei der es sich um niemand Geringeres handelt als die Nichte des Produzenten Carl Laemmle, die sinnigerweise Carla heißt, den Mitreisenden – zwei weiteren, sich gegenübersitzenden stummen Frauen, einem Herrn mit eindrucksvollem Schnauzer und starrem Blick sowie unserem Helden für den ersten Akt, der vornamenlose Häusermakler Renfield – aus einem Reiseführer vorliest: „Among the rugged peaks that frown down upon the Borgo Pass are found crumbling castles of a bygone age.“ Als die Kutsche, wie scheinbar schon mehrmals zuvor, aufgrund der hohen Fahrtgeschwindigkeit und der wenig ausgebauten Straße in eine Schräglage gerät, purzeln die Reisenden für einen Moment durcheinander, und die Gesprächsführung übernimmt der Einheimische mit dem exponierten Oberlippenbart. Er erklärt, die Kutsche müsse so schnell fahren und es sei lebenswichtig, das angepeilte Gasthaus noch vor Sonnenuntergang zu erreichen, denn: „It is Walpurgis Night, the night of evil“, und dann spricht er das Wort aus, das Murnaus Film in der westlichen Welt so populär gemacht hat, obwohl es der rumänische Sprachschatz selbst nicht mal kennt - da es sich vermutlich um eine aus einem Verhörer bzw. mangelnden Sprachkenntnissen resultierenden Wortneuschöpfung der schottischen Reiseschriftstellerin Emily Gerard aus dem späten neunzehnten Jahrhundert handelt: - „Nosferatu.“ An dieser Szene ist einiges interessant: Natürlich, zunächst, kann man sie als ziemlich stichhaltiges Indiz dafür sehen, dass die Verantwortlichen von DRACULA den knapp zehn Jahre zuvor entstanden Murnau-Film gekannt haben müssen, denn der Ausdruck Nosferatu ist, wie gesagt, nun wirklich ein so spezieller, dass er, außerhalb von Frau Gerards Reiseschriften und Murnaus Film, bis dahin kaum irgendwo auftaucht.


Abb.1 & 2: Eine Kutschfahrt durch gebirge Schluchten, fast wie in einem Western. Es sind feine Details, die schon hier auf den metaphysischen Kontext vorliegenden Films verweisen, am prominentesten wohl das Kreuz im zweiten Bild, das wie Warnung und Segen zugleich über der Szenerie thront.
Ebenfalls interessant: NOSFERATU ist, meine ich, ein Film, der, wie kaum ein zweiter, regelrecht davon lebt, dass seine Handlung permanent von schriftlichen Dokumenten begleitet, kommentiert, authentifiziert wird. Sicher, das war schon in Stokers Roman nicht anders, der sich ja ebenfalls aus Tonbandaufnahmen, Tagebuchaufzeichnungen, Briefen etc. zusammensetzt. Murnau und Drehbuchautor Albin Grau haben dieses Konzept jedoch in seinem Kern relativ unverändert vom literarischen Feld ins kinematographische übersetzt, und dort dann sogar noch erweitert, modifiziert, den Anforderungen des neuen Mediums angepasst. Daher beginnt NOSFERATU nicht nur mit einer (fiktiven) Chronik über den Ausbruch der Pest in Wismar aus dem frühen neunzehnten Jahrhundert, und etabliert damit einen Erzähler, den wir den gesamten Film über nicht zu Gesicht bekommen, der sich aber immer wieder, wenn auch nur quasi aus dem Off, ins Geschehen einmischt, sondern präsentiert von Anfang bis Ende außerdem eine wahre Dokumentensammlung aus Briefen Hutters an seine zu Hause gebliebene Frau Ellen in Sütterlin, Logbüchern des Schiffes Empusa, mit dem Graf Orlok nach Norddeutschland reist, Auszüge aus einem Lehrbuch über Vampire, das Hutter im karpatischen Gasthof, statt der obligatorischen Bibel, auf dem Nachttisch findet usw., sodass nahezu jeder Zwischentitel in Gestalt irgendeines Schriftstücks auftritt, das so oder so ähnlich tatsächlich verfasst hätte worden sein können. Als ob Tod Brownings DRACULA sich ironisch von dieser Methode distanzieren wolle – immerhin befinden wir uns inzwischen in der Ära des Tonfilms, in der der Zuschauer vorrangig hören, und nicht mehr lesen muss, um der Handlung folgen zu können -, spielt er in der oben skizzierten Kutschenszene nun gerade das geschriebene gegen das gesprochene Wort aus. Im Reiseführer, aus dem die Dame rezitiert, stehen, soweit man das bei dem einen Satz feststellen kann, mutmaßlich nur malerische Floskeln, die einen nicht über die wahren Gefahren der Gegend um den Borgo-Pass herum aufklären. Das übernimmt deshalb ein mitreisender Einheimischer, der ganz genau davon unterrichtet ist, was da oben, im Schloss des Grafen Dracula, nach Einbruch der Nacht vor sich geht. Renfield ist zwar genauso ungläubig wie Hutter, sein Pendant in NOSFERATU, dennoch ist es, meine ich, auffällig, dass Hutter gleich zwei Warnungen in den Wind schlägt – die des Textes und die der verbali-sierten Sprache -, während Renfiel nur bei einem von beiden ungläubig lachen muss: bei den mündlichen Berichten der rumänischen Dörfler, die er sofort als abergläubisches Gewäsch abtun kann.
Dies mag nun bloß ein zufälliges Detail sein, doch spätestens wenn Bela Lugosi sein ahnungsloses Opfer auf dem Gipfel des Passes erwartet, wo die Einheimischen ihn regelrecht aus ihrer Kutsche werfen, weil sie sich weiterzufahren sträuben, werden die Ähnlichkeiten zu NOSFERATU auch auf der rein bildlichen Ebene evident. Zunächst die Unterschiede: Bei NOSFERATU steht Hutter schon eine Weile wie bestellt und nicht abgeholt in der Karpatenwildnis, als Orloks Kutsche endlich heranrollt – was Murnau Gelegenheit für einen Spezialeffekt gibt, der für heutige Augen zwar leicht zu durchschauen ist – er hat die Fahrt der unheimlichen Kutsche einfach in vielen Einzelbildern aufgenommen, wodurch der Eindruck von Zeitraffung entsteht, und zusätzlich, zumindest in einer Szene, Negativbilder verwendet, sodass das, was eigentlich schwarz ist, z.B. die Bäume des Waldes, auf einmal in gespenstischem Weiß schillert -, für mich aber immer noch ziemlich eindrucksvoll wirkt. Bei DRACULA steht die Kutsche bereits an der vereinbarten Stelle und Renfield braucht bloß noch einzusteigen. Was indes gleich ist: Der Kutscher auf dem Bock ist niemand anderes als Orlok bzw. Dracula höchstpersönlich. Er stiert Hutter bzw. Renfield an, deutet dann, wahlweise mit Peitsche oder dem bloßen Arm, wortlos zur Tür des Gefährts, lässt den Gast einsteigen und saust danach in einer Geschwindigkeit, die noch die der Kutsche vom Anfang übersteigen dürfte, mitten hinein ins Reich der Gespenster. Dass ich Murnaus Version dieses Teufelsritts der Brownings jederzeit vorziehen würde, hat jedoch nicht nur mit den vorzüglichen visuellen Effekten zu tun, die auf mich schon eine beinahe surreale Faszination ausüben. Es sind noch zwei andere Umstände, die DRACULA für mein Befinden sowohl ein bisschen unlogischer als auch ein bisschen putziger, sprich: weniger gruslig, ausfallen lassen: 1. Während Max Schreck als Kutscher sein Gesicht weitgehend verhüllt hält, wie eine Fledermaus eingewickelt ist in seinen Mantel, und einen wundervollen Hut trägt, dessen Feder hoch ist, als wolle sie sich in den Nachthimmel bohren, hat Lugosi es für überhaupt nicht notwendig empfunden, sich irgendwie zu maskieren, d.h. Renfield guckt ihm direkt ins Gesicht – und erkennt ihn nur ein paar Szenen später, wenn er ihm in seinem Schloss gegenübersteht, trotzdem nicht wieder. 2. Während der rasanten Fahrt über Stock und Stein stecken sowohl Hutter als auch Renfield ihre Köpfe aus dem Kutschfenster. Renfield indes sieht etwas, das Hutter nicht beschert ist: Eine süße Gummifledermaus, in die Dracula sich inzwischen verwandelt hat, schwebt über den Pferdenacken und spornt sie mit schrillem Piepsen zu noch mehr Tempo an. DRACULA versprüht in dieser Szene Geisterbahnstimmung, während ich mir bei NOSFERATU vorkomme, als würde ich ein paar Jahrhunderte zuvor in einem komplett abgedunkelten Saal bei einer laterna-magica-Aufführung sitzen.


Abb.3 & 4: Portrait des Vampirs als alter Kutscher. Während Max Schreck sorgsam darauf bedacht ist, seine Beißerchen zu verhüllen, sieht Bela Lugosi darin wohl vor allem deshalb keinen Grund, weil ihm sein Drehbuch keine zugestanden hat.
Angekommen im Schloss gibt es eine zweite Szene, die ausschaut, als habe Browning sie mehr oder minder direkt von NOSFERATU kopiert. Renfield schneidet sich in den Finger, und der Graf, sofort lüstern, als er das Blut sieht, pirscht sich an ihn heran, wird aber in letzter Sekunde von einem Kreuz, das der Makler um den Hals trägt und das just in dieser Sekunde unter seinem Kragen hervorrutscht, davon abgehalten, über ihn herzufallen. Anders in NOSFERATU, wo Orlok kein Kruzifix den Weg versperrt – und überhaupt christliche Symbole keine Rolle darin spielen, den Vampir irgendwie auf Abstand zu halten -, und er tatsächlich Hutters blutenden Finger in den Mund bekommt. Möglicherweise wäre eine solche, wenn man denn unbedingt möchte, homosexuell interpretierbare Szene für die US-Zensoren der frühen 30ern schon zu viel des Schlimmen gewesen, bezeichnend ist jedenfalls, dass ausgerechnet ein Kreuz es ist, das den unzüchtigen Kontakt zwischen den beiden Männern vereitelt. Auch zeigt sich NOSFERATU in dieser Szene, einmal mehr, im direkten Vergleich bei Weitem angsteinflößender: Hutter flieht nach dieser Attacke regelrecht vor dem Grafen in sein Schlafgemach, wo erst, wie es in den Zwischentiteln heißt, bei Sonnenaufgang die schlimmen Schatten von ihm weichen. Renfield demgegenüber bekommt von der Blutgeilheit seines Gastgebers nicht das Geringste nimmt: Als der sich vor dem Kruzifix zischend abwendet, denkt der Unbekümmerte, er sei erschreckt von seiner Wunde, und tröstet ihn mit: „Oh, it’s nothing serious. Just a small cut from that paper clip.“


Abb.5 & 6: Die gleiche Szene, nur, wenn man will, aus anderer (Moral-)Perspektive. Bela Lugosi und Dwight Frye wird jeglicher homoerotische Subtext kreuzwedelnd verweigert, während sich zwischen dem zugleich, von seiner Form her, phallischen, und, andererseits, durch den vaginalen Schnitt gleichsam menstruierenden Daumen Gustav von Wangenheims und den Sauglippen Max Schrecks zumindest für Sekundenbruchteile eine innige Verbindung einstellt.
Eine letzte Gemeinsamkeit – und damit enden sie auch schon bei diesem strikt zweigeteilten Film nach gerade mal etwas mehr als zwanzig Minuten: Wie in NOSFERATU – und natürlich Stokers Roman – ist es ein schöner Schoner, der den Grafen aus seiner alten Heimat in seine neue befördert, und wie in NOSFERATU – und natürlich Stokers Roman – ergeht es der Besatzung des Schiffes, das indes bei Stoker Demeter heißt, bei Murnau Empusa und bei Browning wiederum Vesta, recht schlecht, wird sie doch einer nach dem andern vom hungrigsten, wenn auch blinden, Passagier dezimiert. In NOSFERATU sind das wohl mit die beklemmendsten Szenen: Max Schreck stakst an Bord umher, auf der Suche nach verbliebenen Opfern, und der Kapitän, der sich pflichtbewusst ans Steuerrad gefesselt hat, muss hilflos zusehen wie das Untier ihm entgegenkommt. Browning wiederum muss, wohl erneut aus (Selbst-)Zensurgründen, auf solche Schreckensszenen verzichten: Alles, was wir in DRACULA hiervon zu sehen bekommen, sind Schatten, nämlich die der Männer, die das Geisterschiff nach seiner Landung in England inspizieren, und natürlich den des armen Kapitäns, der blutleer an seinem Steuerrad hängt. Es muss wohl nicht extra erwähnt werden, dass DRACULA nun schon zum dritten Mal eine Szene aus NOSFERATU, die im Original nur so birst vor Grauen, heruntergedimmt und in Wacke gepackt hat, um sie einem Publikum zumuten zu können, das nicht die halbe Nacht mit pochendem Herz wachliegen soll.
Zweiter Teil:
Eigentlich ist Tod Browning ein Regisseur, dessen Filme, auf formaler Ebene, recht statisch daherkommen. In DRACULA jedoch findet sich die eine oder andere Kamerafahrt, die man so nicht von seinen vorherigen Werken gewohnt ist. Sich einig scheint die Filmwissenschaft sich darüber zu sein, dass all die Szenen, in denen die Kamera aus ihrer Rolle der weitgehend regungslosen Voyeurin ausbricht, auf Konto von Kameramann Karl Freund gehen. Der hat ihr im Kino der Weimarer Republik zu einer Beweglichkeit verholfen, von der sie zuvor nicht mal zu träumen gewagt hat. Ob nun in Murnaus DER LETZTE MANN (1924) oder in Ewald André Duponts VARIETÉ (1925): Freunds sogenannte entfesselte Kamera scheint keine Grenzen zu kennen, pendelt von einem Zirkustrapez zur erregten Zuschauermenge und wieder zurück oder fährt, wohl eine der ersten Plansequenzen der Filmgeschichte, mit dem Aufzug von oben nach unten durch ein Hotel und dann quer durch die Lobby bis zur Eingangstür. In Hollywood sind Freunds Fähigkeiten dann mehr oder minder die Hände gebunden, und wirken auch in DRACULA wie mit letzter Not in den Film geworfene lebhafte Tupfer, die ihm ein bisschen seine Steifheit nehmen wollen, und es doch nicht so recht hinkriegen. Berühmt ist die Kamerafahrt beim allerersten Auftritt des Grafen und seiner Bräute. Noch während Renfield sich auf der Reise befindet – gerade eben hat er sich von den furchtsamen Gasthofbewohnern die Ohren vollheulen lassen müssen -, schneidet der Film ins Schloss des Saugers und dort in die Gruft, wo sich der Hausherr allmählich aus dem Tagesschlaf erhebt. Die Kamera wird von seinem Sarg beinahe schon hypnotisch angezogen – ähnlich wie seine späteren (weiblichen) Opfer – bis sie endlich auf einer Hand landet, die sich unter dem Deckel hervorzuschieben und umherzutasten beginnt. Ähnliche Effekte wiederholen sich im Laufe des Films: da ist eine Fahrt, in der Eingangshalle des Schlosses, auf Draculas ans Hypnotisieren gewöhnte Augen, die Renfield anstarren wie nichts Gutes, und, viel später, auf das Gesicht Minas, als sie auf dem Balkon ihres Elternhauses ihren Verlobten Harker zu beißen beabsichtigt. Letztere Kamerafahrt zeigt dann auch, dass noch so innovative Einsprengsel nichts an solchen grundlegenden Problematiken wie einem spießigen Drehbuch und unqualifizerten Darstellern zu ändern vermögen. Helen Chandler, die Mina Seward ihren Körper leiht, hätte mit ihrem putzigen Püppchenantlitz wohl nicht mal dann etwas Bedrohliches, wenn man es gewagt hätte, ihren Mund mit dem einen oder anderen Vampirbeißerchen zu bestücken.
Die mit Abstand aufwändigste Kamerafahrt in DRACULA – sogar unter Verwendung eines Krans! – tut bezeichnenderweise übrigens überhaupt nichts zur eigentlichen Handlung bei. Sie findet quasi als Einführung in Dr. Sewards Sanatorium statt. Unter dem Namenszug der Klinik hindurchgleitend, finden wir uns in einem kleinen Park wieder, wo Krankenschwestern mit ihren Patienten die Sonne genießen, sie in ihren Rollstühlen ausführen, oder mit ihnen auf Bänken sitzen, wo sich die Patienten, wie es sich für ein Sanatorium gehört, wie Irre aufführen, und enden, nach einer ausschweifenden Fahrt die begrünte Fassade hinauf, an der mit Gitterstäben versehenen Zelle Renfields, der gerade von seinem Wärter die Insektenjagd verwehrt bekommt. Wie gesagt: diese vergleichsweise lange, vergleichsweise ausschweifende Kamerafahrt hilft der zu diesem Zeitpunkt schon kurz vor der Stagnation stehenden Geschichte narrativ kein bisschen auf die Sprünge, doch ist sie in einem Film, der zu diesem Zeitpunkt schon kurz davor steht zu einem reinen abgefilmten Bühnenstück zu verkommen, eine letzte Oase, an der das Auge sich laben kann.


Abb.7&8: In diesem Film wimmelt es, da Ratten keinen Zutritt haben, vor Gummifledermäusen mehr als auf jedem Rummel. Dies führt entweder zu schmucken Bildkompositionen, in der die Bräute Draculas als fiepende Flatterer von mittelalterlichen Fensterbögen gerahmt werden, oder aber zu seltsamen Einfällen wie dem, in der Bettszene zwischen Mina und Lucy hinter ihnen an der Wand das Batman-Logo zu antizipieren.
Das ist nämlich wohl das Hauptproblem von DRACULA, nachdem die Handlung von Rumänien nach England gewechselt hat: Von mir aus kann ein Film noch so spießig, noch so verklemmt, noch so hausbacken sein, doch die größte Todsünde ist es, wenn ein Film darauf verzichtet, sich genuin kinematographischer Mittel wie Bildkompositionen, Kameraarbeit, Montage etc. zu bedienen, und einfach nur noch darauf beschränkt, seine Figuren in Räumen wie Theaterkulissen endlos schwatzen und dabei hin und her gehen zu lassen – und zwar exakt auf einer imaginären diagonalen Linie, um ja nicht das Gefühl von Raumtiefe beim Zuschauer zu erzeugen! Genau das geschieht nun aber in DRACULA, der offenbar gar nicht mehr verhehlen möchte, scheint es, dass er auf einem Text beruht, der für die Bretter gedacht ist, die vielleicht nicht die Welt, aber einen unterhaltsamen Abend bedeuten. Bestes Beispiel für das, was ich meine, ist wohl die Szene, die etwa bei Minute 38 beginnt und sich wie ein Kaugummi hinzieht bis Minute 48. Knapp zehn Minuten lang befinden wir uns in ein und demselben Raum, dem, könnte man es nennen, Wohnzimmer der Sewards, das, wie eben eine echte Bühnenkulisse, die Folie für die Auftritte verschiedener Figuren liefert. Bis auf eine kurze Einstellung, die Dracula dabei zeigt wie er Mina aus ihrem Schlafzimmer lockt, beschränkt sich Brownings Regie in diesen zehn Minuten darauf zunächst Harker, Seward und Van Helsing in Sorge um Mina zu zeigen, dann letzteren wie er ihren Hals observiert, dann Dracula wie er unter den Anwesenden erscheint, worauf die ihm verfallene Mina sofort ihre Genesung erklärt, dann wie Van Helsing und Harker mittels eines in einem Zigarettenetui eingelassenen Glases herausfinden, dass der Graf gar kein Spiegelbild besitzt, dann wie Mina ins Bett geschickt wird, dann wie Van Helsing den Grafen mit seinem fehlenden Spiegelbild konfrontiert und der ausrastet, sprich: ihm das Etui aus der Hand haut, dann wie Dracula sich wortreich verabschiedet, dann wie Harker glaubt, einen davoneilenden Wolf im Garten zu sehen, dann wie Van Helsing ihm und Seward beizubringen versucht, dass dieser Wolf niemand anderes als Dracula selbst ist, dazwischen wie Dracula Mina becirct und in den Garten schlafwandeln lässt, dann wie Renfield, der sich scheinbar frei im Privathaus Sewards bewegen kann, verrückt lachend Van Helsings Ausführungen über Draculas Untotenexistenz bestätigt, dann wie ein Hausmädchen erscheint, dass Minas Verschwinden bekanntgibt, worauf Harker, Seward und Van Helsing in den Garten stürmen, dann wie das Hausmädchen, warum auch immer, ohnmächtig zusammenbricht und Renfield auf allen Vieren an sie heranrobbt. Genauso einfallslos wie mein vorheriger Satz ist die gesamte Inszenierung dieser Szene ausgefallen. Es passiert zwar viel, es gehen ständig Figuren auf und ab, immerhin begegnen Van Helsing und Dracula sich zum ersten Mal in der Filmgeschichte, aber was nutzt das alles, wenn sich die filmische Ausgestaltung lediglich darauf beschränkt, die Protagonisten in einer schnöden Stube langweilige Dialoge von langweiligen Bewegungsabläufen unterstreichen zu lassen. Da helfen weder Lugosis theatralisches Gestelze noch die Ungläubigkeit Harkers, der Van Helsing immer noch nicht trauen mag, obwohl er mit eigenen Augen gesehen hat, dass Dracula etwas Substantielles, nämlich eine Reflektion in Glas, fehlt, und schon gar nicht das Overacting Dwight Fryes, der bei seiner Renfield-Darstellung spätestens jetzt keine Zügel mehr kennt. Wenn ich jemandem, der den Film noch nicht gesehen hat, sagen würde – was durchaus den Tatsachen entspricht -, dass sozusagen die gesamte zweite Hälfte DRACULAs aus solchen sterbensuninteressanten Bühnenversatzstücken besteht, bei denen uns das visuell Anregendste – beispielsweise die Metamorphosen des Grafen - verwehrt, dafür aber das visuell Spannungsloseste – eben das endlose Gerede, und nochmal Gerede, und nochmal Gerede - penetrant unter die Nase gerieben wird, könnte ich mir vorstellen, dass dieser hypothetische Jemand dankend darauf verzichtet, diese Lücke Filmgeschichte in nächster Zeit schließen zu wollen.
Wenn es indes nur solche inszenatorischen Schwächen wären, könnte man das Ganze ja noch verbuchen unter: der Tonfilm begann sich gerade durchzusetzen, man wusste nicht recht, wie mit dem gesprochenen Wort umzugehen, weswegen viele Filme dieser Zeit eben derart geschwätzig, dialoglastig, steif wirken. DRACULA jedoch weist, zusätzlich zu meinen obigen Kritikpunkten, auch noch eine prinzipielle Schlampigkeit auf, bei der es mir einerseits schwerfällt, noch ein Auge zuzudrü-cken – vor allem, weil ich nur zwei davon besitze -, und meine Mundwinkel andererseits vor unfreiwilliger Komik oftmals mit dem Zucken gar nicht mehr aufhören können. Die zahlreichen, quer über den Film verteilten Anschlussfehler, d.h. Szenen, denen man sofort ansieht, dass sie nicht aus einem Guss entstanden sind, sondern aus zeitlich weit auseinanderliegenden Einstellung behelfsmäßig zusammenmontiert wurden, und das gar nicht erst zu verschleiern versuchen, sind vielleicht nichts, was man nicht auch in anderen Filmen finden kann, wenn man aufmerksam danach sucht, und Gleiches möchte ich für die ebenso zahlreichen Plot-Höhlungen gelten lassen: DRACULA ist auf Grundlage eines Romans, eines Theaterstücks und, wie ich oben hoffentlich überzeugend dargelegt habe, eines früheren Films entstanden, und dabei bleibt eben mal die eine oder andere Logik auf der Strecke. Außerdem sollte man bedenken, dass der Film einige drastische Kürzungen über sich hat ergehen lassen müssen, was wohl mit ein Grund dafür ist, dass z.B. die Nebenhandlung um Minas Freundin Lucy, das erste Opfer Draculas, die nach ihrem Ableben untot über Friedhöfe schleicht, um geraubte Säuglinge auszusaugen, über eine sinnlose Skizze nicht hinauskommt, und viele Fragen offenblei-ben wie die, weshalb der Graf eigentlich überhaupt nach England übersiedeln möchte, oder wieso Renfield ihm mal als hündischer Sklave folgt, dann wieder Seward und Van Helsing nützliche Tipps zur Vampirbeseitigung gibt, mal agiert wie der personifizierte Wahnsinn, dann wieder einigermaßen klare Momente hat, in denen er selbstvorwurfsvoll mit sich ins Gericht geht. Zu guter Letzt kann man auch den für Ohren, die sich mit klassischer Musik auskennen, mindestens bizarren Soundtrack auf historische Ursachen zurückführen: Wenn in dem Moment, als Dracula die Konzerthalle betritt, gut hörbar eine Passage aus Franz Schuberts Unvollendeter Symphonie erklingt, einen Schnitt später jedoch, keine Minute dürfte zwischen den Szenen vergangen sein, plötzlich das Finale von Richard Wagners Meistersinger-Präludium zu hören ist, dann schauen sich entweder Dr. Seward und seine Freunde ein Potpourri aus den schönsten Stücken der Deutschen Romantik an oder aber die Verantwortlichen haben ihren Score eher nach ästhetischen und nicht nach logischen Gesichtspunkten zusammengesucht. Aber – und dieses Aber bitte in den größtmöglichen Lettern lesen -, das alles kommt in seinem Dilettantismus zum einen ziemlich geballt, zum andern gibt es in DRACULA einige Filmfehler zu bestaunen, die wohl nur darauf zurückführen sein können, dass die Verantwortlichen inkompetent oder am Endergebnis schlicht nicht sonderlich interessiert gewesen sind.
Ja, anekdotenreich sind sie überliefert, die Spannungen am Set: dass Produzent Laemmle Regisseur Browning nicht mochte, und Regisseur Browning Kameramann Freund nicht mochte, und das Budget zusammengestaucht, und die Schauspielerriege recht improvisiert zusammengewürfelt wurde usw. Trotzdem! Ich meine, man komme nur noch einmal mit an Bord der Vesta: Prinzipiell besteht die Szene der Schiffsüberfahrt aus zwei disparaten Materialien. Auf der einen Seite haben wir Dracula und Renfield unter Deck, wo sie eins ihrer im negativen Wortsinne bühnenreifen Gespräche führen. Alles wirkt ruhig, gemessen. Man plauscht ohne große Aufregung. Die Szenen, die jedoch an Bord spielen, zeichnen ein komplett anderes Bild. Ein Sturm tobt draußen, nur mit Mühe hält das Schiff sich über Wasser, die Matrosen haben alle Hände voll zu tun, nicht unterzugehen oder den Mast auf die Köpfe zu bekommen. Kein Wunder, denn sämtliche Außenaufnahmen des den Gezeiten trotzenden Schiffes wurden nicht etwa von Tod Browning inszeniert, sondern sind zum Zeitpunkt der Dreharbeiten zu DRACULA bereits satte fünf Jahre alt. Sie stammen aus dem heute vollkommen vergessenen Universal-Streifen THE STORM BREAKER, Regie: Edward Sloman, von 1925, und sind, was man natürlich mit bloßem Auge erkennen kann und was in zusätzlichem Widerspruch zu der kleinen Unter-Deck-Bühne, auf der Dracula und Renfield plaudern, steht, etwa zwanzig Prozent schneller abgespielt worden als im Original, da die Zahl ihrer Einzelbilder unter den 24 lagen, die mit der Einführung der talkies aus Synchronitätsgründen zwischen Bild- und Tonebene zum Standard werden sollten. Ob das Team von DRACULA das nun beabsichtigt hat oder nicht: diese Seereise mit ihrer katastrophalen Montage und ihrem dadurch resultierenden permanenten Wechsel zwischen Kampf ums nackte Leben und gediegenem Blutsaugerkaffeekränzchen bricht die filmische Illusion des Films dermaßen heftig, dass man, wenn man es nicht besser wüsste, schon fast von einem bewusst inszenierten Verfremdungseffekt sprechen könnte.



Abb.9-11: Auf einer Reise nach Rumänien kaufte ich mir eine pipe, mais c'est n'est pas une pipe. Dafür beweist besagte Pfeife in einer von vielen Szenen, in der der Anschlussfehlerteufel seinen Schabernack treibt, einen recht lebhaften Charakter: Anbei sieht man Renfield - der bei Stoker freilich Harker heißt, und bei Murnau Hutter: puh, all diese Namen! - im Gespräch mit einem rumänischen Gastwirt, der ihm rät, er könne alles tun, nur eins nicht, nämlich nach Sonnenuntergang zur Burg des Grafen Dracula zu reisen. Diese drei Einstellungen folgen unmittelbar aufeinander, und, mal abgesehen davon, dass der Gesichtsausdruck des Schnauzbärtigen sich zwischen einem Schnitt und dem nächsten frappierend ändert, und dass der Winkel, aus dem er bei Einstellung 2 gefilmt ist, auch nicht recht zu Einstellung 1 und 3 passen mag, ist es vor allem seine munter von der linken in die rechten Hand wechselnde Pfeife - was für ein cooles Ding aber! -, die meine Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Noch viel amateurhafter – und für ein postpostmodernes Publikum noch entzückender – wird es, wenn man etwas im Bild vergisst, das dort überhaupt nicht hingehört. Ein Beispiel gefällig? Betreten wir doch einmal Minas Schlafzimmer, als unsere Heldin dort den Schlaf der Schönen und Reichen schläft, und deshalb nicht mitbekommt, dass Lugosi die Tür zu ihrer Kammer aufstößt und raubtierhaft zu ihrem Bett schleicht. Im Bildvordergrund sehen wir Minas Nachttischlampe, eingeschaltet, als fürchte sie die Nacht. Aber was ist das? Da hängt doch ein Stück Pappe vor der Lampe, oder nicht? Wieso hat ein junges Mädchen aus gutsituiertem Elternhause eine Pappe vor ihrer Nachttischlampe kleben?! Nun, zu 99,9% dient diese Pappe, meine ich, wohl dem rein pragmatischen Grund, dass das Licht der Lampe, wenn sie, wie jetzt, brennt, nicht bei close-ups, z.B. von Gesichtern, auf diese fallen soll, sprich: der Beleuchter oder Kameramann wird sie angebracht haben, sie ist ein extradiegetisches Element par excellence. Gerne können die Hollywood-Horrorspezialisten mit ihren Requisiten anstellen, was sie wollen, und diese Pappe scheint ja gut und nützlich gewesen zu sein bei Portraitaufnahmen, aber was ich beim besten Willen nicht verstehe: wie hat es dieses Stück Pappe denn bitteschön in den Endschnitt geschafft?, wie viele Instanzen musste sie wohl durchlaufen, um dort zu landen?, und: das dann auch noch gleich in drei Szenen? – denn: bei einem späteren Besuch Draculas hält sie noch genauso ihre Stellung wie als Minas Vater und Van Helsing noch später ratlos in ihrem Zimmerchen herumstehen und sich fragen: Wo steckt die Gute bloß?! In einem italienischen Trash-Film aus den 70ern und 80ern wundere ich mich über nichts mehr, aber das ist doch... fuckin' Hollywood, nicht?



Abb.12-14: Graf Dracula hat *fast* statt süßem Jungfernblut den Geschmack von Pappe im Mund. Sobald man die Lampe mit ihrer angeklebten Pappe jedenfalls erst einmal entdeckt hat, wird man sie den ganzen Film über nicht mehr los.
Dritter Teil
Allerdings – und ich bin fast geneigt, mich von diesen Szenen so versöhnlich stimmen zu lassen, dass ich DRACULA alles verzeihe, was ich ihm in den obigen Zeilen an Kritik vor die Füße geworfen habe – steckt dieser Film in seiner vergleichsweise vorzüglichen ersten Viertelstunde auch voller Tierchen, die man nicht nur in den Karpaten eher selten antrifft, sondern auch in klassischen Spielfilmen viel zu selten zu Gesicht bekommt. Man leitet sich das Vorhandensein von Opossums und Gürteltieren im gräflichen Schloss üblicherweise wie folgt her: Im Hollywood war der sogenannte Production Code, d.h. die Vorschrift darüber, was in einem handelsüblichen Kinofilm gezeigt werden durfte und was nicht, zwar noch nicht im Gesetz verankert – das sollte erst wenige Jahre nach DRACULA geschehen -, dennoch hielten die Studios sich selbstzensorisch natürlich an gewisse ungeschriebene Vorgaben wie zum Beispiel, um gleich mal beim härtesten Tobak zu beginnen, das Vermeiden sexueller Darstellungen oder aber das Verunglimpfen von Autoritäten wie Staat und Kirche. Was jedoch ebenfalls nicht vor die Augen der US-amerikanischen Zuhörerschaft kommen durfte, das waren als eklig geltende Tiere wie vor allem Ratten - während sie, wir erinnern uns, bei NOSFERATU noch derart als Legion auftreten, dass sie quasi von der Leinwand purzeln. Was sollen aber die Verantwortlichen eines Schauerfilms wie vorliegendem tun, wenn sie das Schloss des Titelhelden nicht bloß mit den sowieso bereits omnipräsenten Gummifledermäusen ausstaffieren möchten? Nun, man nimmt eben einfach ein paar Vertreter aus der heimischen Fauna - das wird schon niemandem auffallen, denn der normale US-Kinobesucher 1931 hätte Rumänien sicher nicht auf einer Landkarte Europas auf Anhieb finden können, nehme ich an und haben wohl auch die Leute bei Universal angenommen, weshalb sich im Haus des Saugers, zwischen Spinnenweben und Särgen, eben solche muntere Gesellen tummeln wie Opossums, Gürteltiere und…, was ist denn das?, eine Biene?!




Abb.15-18: Murnaus "Wehrwolf". Ein Opposum. Zwei Gürteltiere. Ein Insekt namens Jerusalem Cricket (wissenschaftlicher Name: stenopelmatus). Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder ist sie ein riesengroßes Ungetüm, das schon vorverweisen soll auf die Rieseninsekten-Thriller der 50er wie FORMICULA oder TARANTULA - oder aber wir wohnen hier gerade einer der wenigen genuin surrealen Szenen des Hollywood-Kinos der 30er bei.
Tja, und damit kommen wir nun endlich zu dem einen Moment, für den ich DRACULA dann doch über alle Maße feiere, vielleicht gerade weil mir bislang niemand recht die Frage beantworten konnte, was man sich wohl dabei nur gedacht haben mag, einen Miniatursarg anzufertigen und aus diesem ein in Kalifornien nicht seltenes Tierchen – für das es im Deutschen scheinbar gar keine Bezeichnung gibt - namens Jerusalem Cricket krabbeln zu lassen? Falls Särge in Filmen ebenfalls verboten gewesen wären, könnte ich das ja verstehen - doch das sind sie offenkundig nicht, denn in den umliegenden Szenen erheben sich Dracula und seine Bräute aus ebensolchen. Ist das Surrealismus, ein Schalk im Nacken? Noch einmal: ein Gürteltier auftreiben, ein Opossum, und die in eine Gothic-Kulisse setzen, okay, klar, das ist keine große Sache, ziemlich schräg zwar, aber gut – und hat seinen Vorläufer sogar wiederum in NOSFERATU, wo uns in einer denkwürdigen Szene ja ebenfalls eine Hyäne als, wie er im Zwischentitel genannt wird, Wehrwolf verkauft. Aber einen - ich wiederhole: - Miniatursarg basteln, und in dem eine Biene beisetzen, die dann nach Mitternacht zu neuem Leben erwacht!? Großartiger Film, irgendwie, für ein paar Sekunden zumindest.
Über manchen Film wurde bereits so viel geschrieben, dass man sich fragt, wozu man da nun noch unbedingt seinen eigenen Senf hinzugeben muss? Aber wie viele Liebesbriefe mögen schon verfasst worden sein - selbst wenn sie dann nicht abgeschickt wurden und ungelesen im Ofenfeuer landeten? Sollte ich deshalb nur das lesen, was schon ist, mich ausruhen auf dem, was andere für mich getan haben, zu einem Straßenschild werden, das bloß das benennt, was sowieso schon da ist?