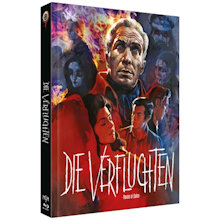Poe im (frühen) Kino, Folge 3:
Die wohl selbst heute noch mit Abstand populärste Verfilmung der Poe-Kurzgeschichte THE FALL OF THE HOUSE OF USHER dürfte jene sein, mit der Roger Corman im Jahre 1960 den Auftakt zu einer ganzen Reihe von Filmen gab, die sich in Form und Inhalt mehr oder minder auf den amerikanischen Dichter berufen. Bereits in diesem Werk sind sämtliche Ingredienzien vereint, die Corman in späteren Poe-Adaptionen beibehalten bzw. verfeinern sollte: gotische Studiokulissen, die den Vergleich mit den zeitgleich entstandenen Erzeugnissen der britischen Hammer-Studios nicht zu scheuen brauchen, dazu Elemente des Grusels, wie man sie bis in die klassische Schauerliteratur des siebzehnten Jahrhunderts zurückverfolgen kann, wie meterdicke Nebelschwaden, umherschwirrende Fledermäuschen, von Decken baumelnde Stricke aus Spinnweben, unheimliche Grüfte und jede Menge Geheimgänge in halbverlassenen Schlössern, und natürlich ein Vincent Price, der, abonniert auf Rollen derangierter und degenerierter Charaktere, mit seiner Theaterbühnentheatralik den übrigen Cast gnadenlos an die Wand spielt. Im Kontext einer Untersuchung von Filmen, die sich auf Poes Usher-Story berufen, ist indes, meine ich, von besonderer Wichtigkeit der Titel des vorliegenden Werks. Während Jean Epstein und das Regie-Duo Melville und Webber, die beide, unabhängig voneinander, im Jahre 1928 eigenständige Verfilmungen der Erzählung vorlegten, den Titel der short story, wie man es von Literaturverfilmungen gemeinhin erwartet, eins zu eins für ihre Filme übernommen haben, sodass sie folgerichtig THE FALL OF THE HOUSE OF USHER bzw. LA CHUTE DE LA MAISON USHER heißen, findet bei Corman eine interessante Verkürzung statt. HOUSE OF USHER, dieser Titel deutet bereits, bevor man überhaupt eine Minute des dazugehörigen Films gesehen hat, darauf hin, dass der Fokus nicht so sehr auf dem Niedergang von Haus und Familie Usher liegt, als auf diesem Haus respektive der Familie selbst – eine Akzentverlagerung, die der knapp achtzigminütige Film dann, zumindest für mich, weitgehend bestätigt hat.
Den entscheidendsten Eingriff in die literarische Vorlage leistet Drehbuchautor Richard Matheson sich, indem er die Figur des Fremden, der das abgelegene Anwesen der Geschwister Usher besucht, und dort Zeuge von derer zunehmend um sich greifenden Wahnsinn wird, aus ihrer verhältnismäßigen Anonymität reißt und ihr sowohl einen Namen, nämlich Philip Winthrop, als auch eine Agenda verleiht. Erinnern wir uns: in Poes Geschichte ist der namenlose Ich-Erzähler ein alter Studienfreund Roderick Ushers, der dessen Schwester Madeleine bei seiner Ankunft zum ersten Mal zu Gesicht bekommt. Ganz gemäß der Vorlage sind Epstein und Melville/Webber mit der Figur verfahren. Bei letzteren findet der gute Herr nahezu kaum statt, verschwindet regelrecht unter den überbordenden Stilexperimenten, mit denen sich ihr Kurzfilm jeder konventionellen Narration verweigert, bei Epstein hat der Fremde zwar schon mehr Profil, scheint aber vordergründig hauptsächlich dazu zu dienen, den Blick des Publikums zu teilen und, erneut wie in der Erzählung Poes, als vermittelnde Instanz zwischen diesem und den Vorgängen im Usher-Schlösschen zu fungieren. Philip Winthrop allerdings ist von Anfang an bis über beide Ohren in die Familienangelegenheiten der Ushers verstrickt. Weshalb?, wird man fragen und die Antwort ist so banal wie genial: er lernt nicht Madeleine bei seinem Eintreffen im Usher-Landsitz kennen, sondern deren Bruder, Roderick, denn mit ihr hat er bereits Bekanntschaft in Boston geschlossen, und nicht nur das, sind die beiden doch verlobt und Philip deshalb zu ihr gereist, um seine schöne Braut mit sich in ein buntes Großstadteheglück zu entführen. Dagegen legt Roderick freilich sofort sein vehementestes Veto ein. Nicht nur den Heiratsplänen seiner Schwester steht der physisch und psychisch am Rande der Selbstauflösung balancierende letzte männliche Familienspross mehr als kritisch gegenüber, er bittet Philip inständig, das Schloss zu verlassen, ohne Madeleine überhaupt davon unterrichtet zu haben, dass er gekommen sei. Als die ihn schließlich aber doch bemerkt, ist der Entschluss des Verliebten unumstößlich: er wird nicht zulassen, dass seine Liebste weiterhin dem, wie er meint, schädlichen Einfluss ihres schwerkranken Bruders ausgesetzt ist, und sie in den sicheren Hafen der Ehe führen. Rodericks Beteuerungen, dass die Familie endlich untergehen müsse, dass Madeleine und er sowieso bereits auf der Liste des Todes weit oben stünden, dass er, Philip, eine unbegreifliche Schuld auf sich lade, wenn er mit Madeleine Kinder zeugen würde, helfen nichts und der Abreise stellt sich als letzter Hinderungsgrund das vermeintliche Ableben Madeleines in den Weg, die Philip tot in sich zusammengesunken auf dem Fußboden von Rodericks Schlafzimmer auffindet. Gezeichnet von seiner Trauer und irritiert von den dramatischen Reden, die Roderick noch am Sarg der Toten schwingt, will Philip nun doch schnellstmöglich das Weite suchen, wird aber von einer unbedachten Äußerungen Bristols, des Hausdieners, davon abgehalten. Der spricht davon, dass Madeleine früher schon an kataleptischen Anfällen gelitten habe, und nährt, obwohl er die Bemerkung sofort zurückzunehmen versucht, in Philip einen schrecklichen Verdacht: ist seine Angebetete am Ende lebendig in die Familiengruft gebettet worden? Ihr Sarg jedenfalls, davon überzeugt er sich eigenhändig, gähnt vor Leere...
Es ist erstaunlich, aber allein durch die Tatsache, dass der Usher-Gast in HOUSE OF USHER seiner Beobachterrolle entkleidet und zum eigentlichen Helden des Films gemacht wird, unterscheidet sich Cormans Adaption grundlegend von denen Epsteins und Melvilles/Webbers knapp drei Jahrzehnte zuvor. Nicht so sehr der sukzessive seelische und körperliche Verfall von Roderick und Madeleine steht bei HOUSE OF USHER im Vordergrund, sondern das Bestreben Philips, seine Verlobte den Fängen ihrer Familienvergangenheit und vor allem dem Einfluss ihres Bruderherzes zu entreißen. Wo Melville/Webber und Epstein vornehmlich damit beschäftigt sind, Stimmungsgemälde zu entwerfen, die mehr fühlen als verstehen lassen, hat Corman einen handfesten, sich seinen Genre-Regeln völlig ergeben zeigenden Gruselfilm inszeniert, in dem es an nichts fehlt, um seinem Publikum einen wohligen Schauer nach dem nächsten zu verschaffen. Tatsächlich sind die weiteren Variationen marginal, der Kern der Geschichte bleibt unangetastet von irgendwelchen Zugeständnissen an möglicherweise veränderte Sehgewohnheiten. Wie Epstein und wie Melville/Webber und wie vor allem Poe selbst lässt Corman sich die Tragödie kammerspielartig einzig und allein in den Gemächern des Schauerschlosses entfalten, und dass er eine vierte Figur in das unheilvolle Liebesdreieck hineingesponnen hat, nämlich den Diener Bristol, fällt, zumal die Figur sich angenehm im Hintergrund hält, kaum weiter ins Gewicht. Bezeichnend ist sie dennoch aus einem anderen Grund, der Cormans Fassung dann doch grundlegend von den beiden früheren trennt. Wo Epstein und Melville/Webber ihre Geschichten unisono ihren Bildern unterstellen, d.h. letztere als wesentlich wichtiger erachten als erstere, scheint mir das Verhältnis bei Corman exakt umgekehrt. Nicht dass HOUSE OF USHER an Bildern geizen würde, die vor allem Menschen mit einem Faible für klassisches Horrorkino aus dem entzückten Jauchzen kaum herausließen, trotzdem ist der Film, verglichen eben vor allem mit den nun schon mehrmals erwähnten Usher-Vorgängern, sowohl was seine technische als auch was seine ästhetische Seite betrifft, reichlich konventionell umgesetzt worden, und erinnert mich streckenweise mehr an ein mit filmischen Mitteln transportiertes Theaterstück als an einen Film, der die ihm gegebenen Mittel wie Montage oder Kameraarbeit genuin filmisch umsetzen würde. Erneut kann der Entschluss, dem Fremden Namen und die eine oder andere süßliche Schmachtszene zu geben, davon Bände sprechen. Philip Winthrop ist, um das noch einmal ausdrücklich zu betonen, kein relativ außenstehender Betrachter des familiären Schreckensszenarios, sondern stattdessen mitten in dieses involviert: er beobachtet nicht, er agiert, wodurch HOUSE OF USHER zwangsläufig nie in die Versuchung kommt, tatsächlich, wie es Melville/Webber vorführten, mit wehenden Fahnen in die erkrankte Psyche Rodericks einzutauchen, oder, wie Epstein es in einigen der besten Szenen seiner Adaption tut, einen distanzierten Standpunkt einzunehmen, von dem aus es möglich ist, Verwelken und Verfallen von Schloss, Menschen, Natur mit der morbiden Faszinationen von jemandem beizuwohnen, der selbst nicht davon betroffen ist.
Nur einmal deliriert es in HOUSE OF USHER ordentlich. Es handelt sich um eine Traumvision Philips, die dieser erleidet, kurz nachdem Roderick ihn durch die Ahnengalerie der Familie geführt hat. Von der liest man bei Poe zwar noch nichts, in HOUSE OF USHER sind die in grellen Farben gemalten expressionistischen Gemälde wichtige Marker, um den schrittweisen Zerfall des Geschlechts nachvollziehen zu können. Bitterböse Schiffskapitäne finden sich darunter, Kinderschänder, Massenmörder, Huren. Diese erlauchte Gesellschaft sucht Philip nun in seinem Traum heim, von Corman wie ein kleiner, eigenständiger Experimentalfilm inszeniert, den man problemlos als eine kurze Verbeugung vor der Version Melvilles und Webbers verstehen könnte. Verwaschen sind die Bilder, durch mehrere verzerrende Filter gejagt, alles schwimmt impressionistisch ineinander, menschenähnliche Hände greifen nach der Kamera, es taumelt wie bei einem schlechten Drogentrip. Dass Philip, und nicht Roderick, diese verworrenen Traumgesichte erleben darf, beweist einmal mehr den signifikanten Perspektivwechsel, den ich nun schon seit mehreren Zeilen deutlich zu machen versuche. Ansonsten ist HOUSE OF USHER in seiner Inszenierung nämlich recht bieder, zuweilen gar betucht, und veranschaulicht die seelischen Katastrophen, die vor allem im Körper Rodericks schlummern, weitgehend über Dialoge oder die expressive Gestik und Mimik Vincent Prices. Der ist überempfindlich für nahezu alles: selbst das Geräusch von Schuhabsätzen auf dem Parkett erregt ihn ungemein, das Rascheln von Kleidung, Berührungen seiner Haut. Tagelang verfolgen bestimmte Gerüche ihn, martern ihn Töne, die sich ihm in die Gehörgänge eingebrannt haben. Einzig das Spiel seiner Laute verschafft ihm etwas Linderung. Vielleicht meine liebste Szene des gesamten Films beinhaltet gerade dieses Musikinstrument, dem Price mit seinen dürren, langen Fingern in die Saiten greift, um komplett atonale Musik aus ihm hervorzulocken. Währenddessen wohnen ihm Madeleine und Philip lauschend bei. Ob das eine Eigenkomposition sei, fragt Philip. Roderick bejaht, worauf Philip ihn bittet, doch noch etwas zum Besten zu geben. Für mich besonders interessant ist Cormans Umgang mit dem, was man Anfang der 60er wohl noch als Avantgardekunst bezeichnet hat. Gleich drei Felder, die zu dieser hinführen, eröffnet er in HOUSE OF USHER: neben Rodericks tatsächlich großartig-verstörendem Lautenspiel, das mich mehr ängstigte als der gesamte Restfilm, sind das die bereits erwähnten halb-abstrakten Familiengemälde sowie die kurze Traumsequenz, in der Corman sich dem annähert, was zu seiner Zeit an Experimentalfilm virulent gewesen sein dürfte. Ob man aus der Verwendung von atonaler Musik, expressionistischer Malerei und avantgardistischem Filmemachen in HOUSE OF USHER – alle drei Kunstformen werden offensichtlich mit dem Krankhaften, dem Entarteten, dem Anormalen assoziiert -, nun wirklich auf einen reaktionären Subtext schließen darf, lasse ich indes tunlichst dahingestellt.
Letztlich ist HOUSE OF USHER für mich unterm Strich kein schlechter Film, sogar einer der besten, die ich von Corman überhaupt kenne, ein unterhaltsames Stück Kino aus einer Zeit, als es noch gereicht hat, seines Publikums Puls zu erhöhen, ohne alle paar Minuten jemanden auszuweiten, zu köpfen oder zu zerstampfen. Verglichen mit den beiden vorherigen Usher-Verfilmungen verliert er für mich jedoch eindeutig an Reiz. Nichts in ihm hat mich derart entsetzt wie die markerschütternde Schlussszene in Melvilles und Webbers THE FALL OF THE HOUSE OF USHER und nichts in ihm hat mich derart berührt wie die Grablegungen Madeleines, die Jean Epstein in LA CHUTE DE LA MAISON USHER mit Aufnahmen von kopulierenden Kröten kontrastiert. Selbst das Finale mit Pauken und Trompeten, in dem Madeleine und Roderick mitsamt ihres Familienschlosses im Tümpel versinken und Philip gerade noch so mit halbwegs heiler Haut davonkommt, kann für mich nicht an die Untergangsphantasien aus dem Jahre 1928 heranreichen. Jeder, dem indes der Sinn nach altmodischem Spuk steht, ist mit HOUSE OF USHER bestens beraten.