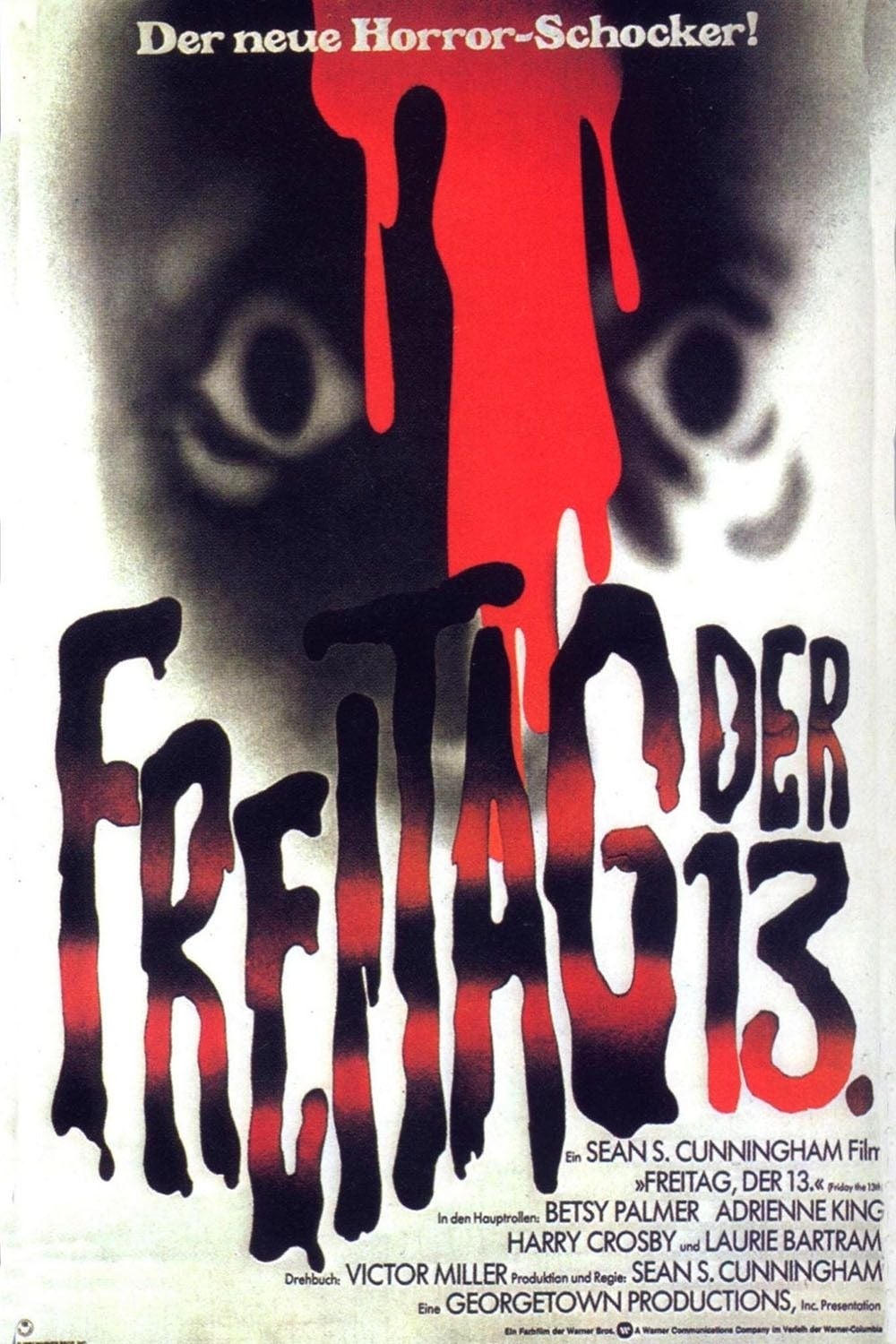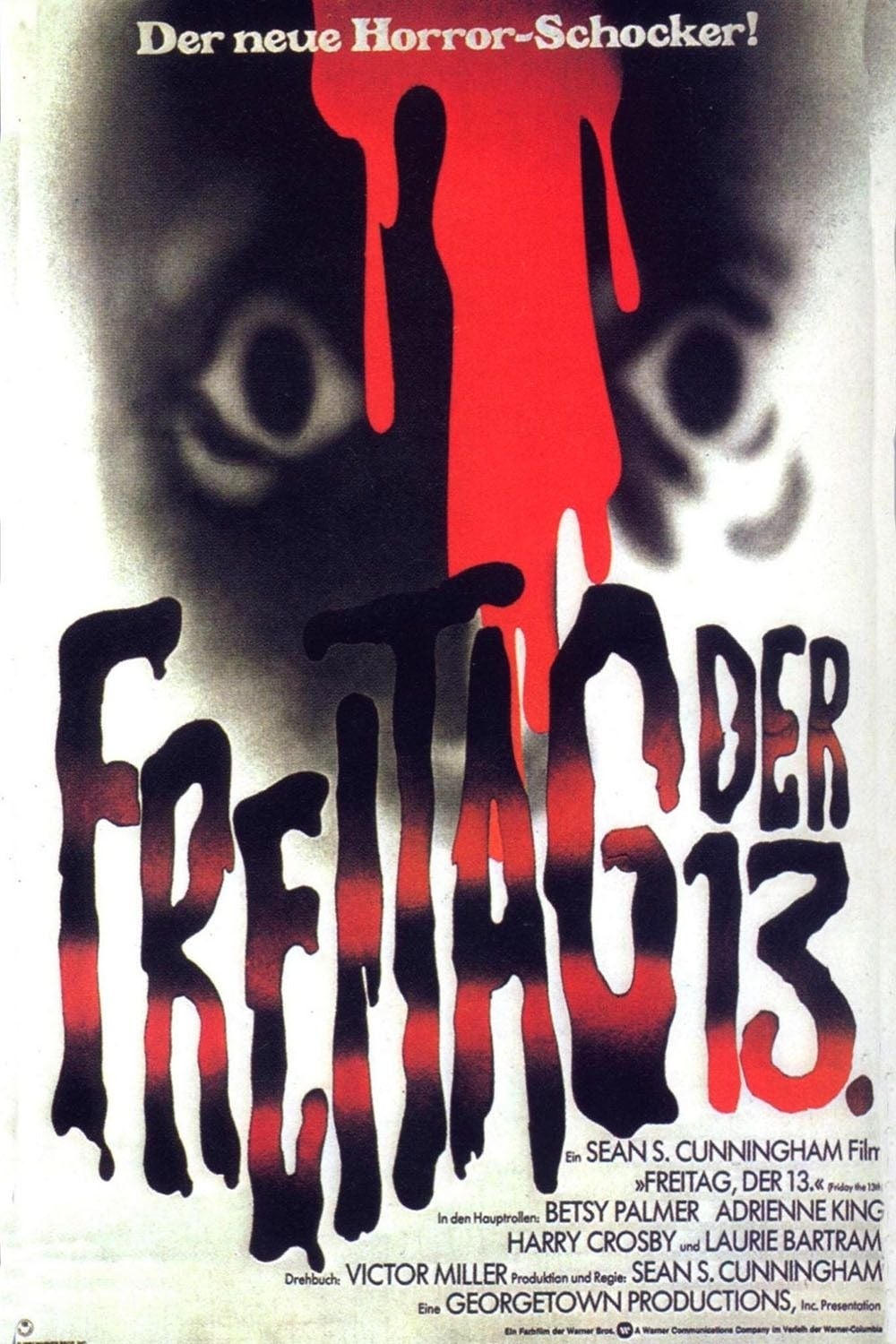
Freitag der 13.
Eine Gruppe Jugendlicher verbringt ihre Ferien im "Camp Crystal Lake", einem Feriencamp, in dem vor Jahren der kleine Jason Vorhees ertrunken ist. Nach einiger Zeit beginnt eine grausige Mordserie unter den Jugendlichen. Der Täter ist ihnen dabei näher als sie denken...
„Das Blutcamp? Wird das etwa wieder eröffnet?“
Nach einer genrefremden Zusammenarbeit mit Wes Craven („A Nightmare on Elm Street“) bewies der US-Amerikaner Sean S. Cunningham bereits 1972 einen guten Riecher für provokante Low-Budget-Produktionen und finanzierte Craven den
Rape’n’Revenge-Prototypen „Last House on the Left“. Nachdem John Carpenter mit der ebenfalls sehr kostengünstigen Produktion „Halloween“ aus diversen Psycho- und Horror-Thrillern, allen voran „Black Christmas“, Elementares herausfilterte und einen ebenso minimalistischen wie furchterregenden und vor allem finanziell einträchtigen Film erschuf, der das Subgenre des
Slasher-Films begründen sollte, kratzte Cunningham ebenfalls läppische rund 500.000 Dollar zusammen, ließ Drehbuchautor Victor Miller Charakteristika aus „Psycho“, „Halloween“ und manch Prä-
Slasher zwischen beiden, allen voran Mario Bavas
Giallo „Bay of Blood“, zusammenwürfeln, nahm selbst auf dem Regiestuhl platz und ließ im Jahre 1980 mit „Freitag der 13.“
den Archetypus des Camp-
Slashers auf ein begeistertes Publikum los, das einen feuchten Kehricht auf die vernichtenden Kritiken gab, den Film zu einem riesigen Erfolg machte und derart viele Fortsetzungen provozierte, dass die „Freitag der 13.“-Reihe die langlebigste der Horrorfilmgeschichte überhaupt geworden ist.
„Ihr seid verdammt! Ihr seid alle verdammt!“
Auf dem idyllischen Camp Crystal Lake scheint ein Fluch zu lasten: Erst ertrank dort 1957 ein Junge, dann wurden 1958 zwei Camp-Aufseher ermordet, der Täter nie gefasst. Seither besitzt das Camp den Kosenamen „Blutcamp“ und wird gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Doch 20 Jahre später will ein neuer Betreiber mithilfe einiger Jugendlicher allen Unkenrufen zum Trotz das Camp neu eröffnen. Man schlägt alle Warnungen in den Wind und beginnt mit den Arbeiten, doch nach und nach wird die Gruppe von einem unbekannten Mörder dezimiert...
„Wir wollen hier keine Ausflipperei!“
Mit „Black Christmas“ begann die Tradition, die Handlungen von
Slasher-Filmen gern zu besonderen Anlässen spielen zu lassen. Statt Weihnachten wählte Carpenter die Halloween-Nacht und Cunningham suchte sich den als Unglückstag verschrieenen 13. eines Monats, der auf einen Freitag fällt. Der Beginn mit einer Rückblende wurde dabei von „Halloween“ entlehnt, die aufgedrehten Streicherklänge des Soundtracks erinnern nicht von ungefähr an „Psycho“, das pittoreske See-Ambiente kennt man aus „Bay of Blood“, den kauzigen, warnenden Einheimischen, den niemand ernst nimmt, aus
Backwood-Terror-Filmen, die subjektive
Point-of-View-Wackelkamera aus „Halloween“ und manch früherem Vorreiter-Werk. Doch „Freitag der 13.“ versteht es nicht nur, all diese Versatzstücke nahezu perfekt zusammenzufügen, sondern wählt geschickterweise im Gegensatz zu „Halloween“ (für den Michael Myers von vornherein als Mörder feststand) das
Whodunit?-Prinzip aus „Psycho“ und Konsorten, was ihn zu einem kongenialen
Plottwist befähigt. Außerdem nahm man die Möglichkeit wahr, mit Tom Savini einen echten Experten für Spezialeffekte zur Zusammenarbeit zu bewegen, dank dessen SFX-Kunst die blutigen Morde besonders gelungen umgesetzt werden konnten. Komponist Harry Manfredini drückte zudem der ganzen Filmreihe seinen Stempel auf und sorgte für ein Alleinstellungsmerkmal, indem er infolge eines Geistesblitzes das charakteristische „Kikiki... Mamama...“-Sample aus dem Imperativ
„Kill her, Mommy!“ formte, selbst einsprach und dadurch eine bedrohliche Klangkulisse schuf. Das zeitweilige Banjo-Spiel wiederum – spätestens seit „Beim Sterben ist jeder der Erste“ mit einer unheimlichen Aura versehen – unterstreicht den
Backwood-Charakter des Films. Musik findet indes nur dann Verwendung, wenn der Mörder in unmittelbarer Nähe ist, ansonsten herrscht Stille im
Off.
„Wir spielen Strip-Monopoly!“
Dem kargen Budget geschuldet ist das Ensemble junger, unerfahrener Schauspieler, lediglich Betsy Palmer („Ehe in Fesseln“) sowie aus heutiger Sicht der damals noch am Karriereanfang stehende Kevin Bacon („Im Land der Raketenwürmer“) stechen aus der „namenlosen“ Besetzung hervor. Doch „Freitag der 13.“ beweist, dass für das Erzeugen einer Sommer-Camp-Stimmung mit leichtbekleideten Jugendlichen herausragendes schauspielerisches Talent zweitrangig ist. Vielmehr gilt es, eine Atmosphäre der juvenilen Sorglosigkeit und Unbedarftheit, des Übermuts, des pubertären Geltungs- und Balzdrangs zu schaffen, die ebenso albern wie erfrischend wirkt. Die (vermeintliche) Leichtigkeit des Seins schlägt sich in oberflächlichen Ritualen und Dialogen wieder, lädt ein zum entspannten bis voyeuristischen Beobachten und Verweilen, doch erweist sich – wie auch in der Realität – als nur allzu trügerisch, wenn einer nach dem anderen dafür mit seinem Leben bezahlt (wie hoffentlich weniger häufig in der Realität). Folgerichtig wird die Sommerstimmung alsbald durch den genretypischen Prasselregen in all seiner Unwirtlichkeit ersetzt und zwischen dem mit dramatisierenden Zeitlupen arbeitenden Beginn und Ende des Films manch Mord in Hitchcock'scher Spannungsmanier vorbereitet und ausgeführt. Dass es dabei vornehmlich diejenigen trifft, die sich gern dem Drogen- und/oder Sexualrausch hingeben, wird Filmen dieser Art oft als erzkonservativer Moralismus vorgeworfen, erfüllt jedoch einen anderen Zweck, in „Freitag der 13.“ gar in doppeltem Sinne: Zum einen erschreckt sich der die Szenerie kritisch Beäugende, der das Treiben der Jünglinge tatsächlich für amoralisch und prinzipiell bestrafenswürdig hält, vor der blutigen Konsequenz, mit der die Opfer ihre „Züchtigung“ erfahren, die sie nie wieder an derartige Flausen denken lässt, da sie schlichtweg aus dem Leben scheiden. Dem vorehelichem Sex, Drogenkonsum etc. ablehnend gegenüberstehendem Teil des Publikums halten diese Szenen einen hässlichen Zerrspiegel vor, der dessen Vorstellungen von Erziehung zu „Sitte“ und „Moral“ gnadenlos überzeichnet und dadurch auf abstoßende Weise parodiert. Bei genauerer Betrachtung erschließt sich dem offengeistigen Genrefreund indes, dass diese Szenen gar nicht so hässlich und abstoßend sind, sondern einer morbiden und makabren Ästhetik des kreativen, originellen Mordens folgen, die mutmaßlich ihren Anfang im italienischen
Giallo nahm. Zum anderen erfährt der Zuschauer hier im Finale, was tatsächlich 1957 im Camp geschah (Achtung, ab jetzt Spoiler!) und erkennt endlich das Motiv: Sorglosigkeit, Geilheit und juveniler Egoismus waren es nämlich, die damals einem Außenseiter, dem unter dem Down-Syndrom leidenden Kind Jason Voorhees, das Leben kosteten, als sich die Camp-Aufseher lieber einem Schäferstündchen hingaben, statt ihre Verantwortung für die Schwachen unter ihnen wahrzunehmen: Jason war ein schlechter Schwimmer und ertrank. Und nun ist es seine einsame Mutter, die darüber den Verstand verlor und sich auf einem andauernden Rachefeldzug befindet – wie die für alle Genre-Neulinge, die bereits in „Freitag der 13.“ Jason als Mörder wähnten, überraschende Auflösung im überaus spannend inszenierten Finale erzählt, das Betsy Palmer als Pamela Voorhees schnell eine unheimliche Leinwandpräsenz entwickeln lässt. Sie wurde eins mit ihrem Sohn wie Norman Bates aus „Psycho“ mit seiner Mutter – ein ebenso einfacher wie genialer Schachzug, der die Vorzeichen des Genre-Seniors kurzerhand umdreht und damit auch die psychopathologischen Hintergründe der
Slasher-Täter weiter manifestierte. Das Finale definiert darüber hinaus den Freitag, 13., als Jasons Geburtstag und Adrienne King („Nur Samstag Nacht“) als
Final Girl nach Vorbild Jamie Lee Curtis' in „Halloween“. Das Etablieren einer starken weiblichen Rolle als letzte, meist wehrhafte Überlebende im Subgenre spricht ebenso gegen einen reaktionären Machismo wie das Meucheln sexuell aktiver Jugendlicher eben kein Plädoyer für religiös motivierte Enthaltsamkeit ist, sondern die Rache aus der Gesellschaft attraktiver, sportlicher, in mancherlei Hinsicht erfolgreicher Jugendlicher Ausgestoßener, Außenseiter, Kranker, unangenehm an die Schattenseiten des Lebens Erinnernder darstellt, die nur allzu oft und gerne vergessen werden, über die manch einer froh ist, sie nicht in seiner Nähe zu haben, die nur beim fröhlichen Balzen und Pimpern stören. Manch
Slasher veranschaulichte dies mehr, mancher weniger, der eine todernst, der andere mit selbstironischem Augenzwinkern. Der Tonfall in „Freitag der 13.“ ist grundsätzlich ernst, wird jedoch durch einige kleinere Streckszenen und jugendliche Alberei immer mal wieder durchbrochen.
Es dürfte unschwer zu erkennen sein: Ich bin bekennender Freund des Subgenres im Allgemeinen und dieses Films im Speziellen, halte ihn gar für eine fast perfekte Symbiose aus „Psycho“, „Bay of Blood“ und „Halloween“, für einen Überraschungserfolg, der etwas lostrat, wovon Cunningham in seinen kühnsten Träumen nicht ausgehen konnte, der durch solide Handarbeit aller Beteiligter mehr wurde als die Summe seiner Einzelteile. Doch auch, wenn Kritiker sicherlich nicht zu Unrecht konstatieren mögen, dass das doch alles zusammengeklaut wurde, ein kommerzieller
Rip-Off wäre, um sich an Carpenters Erfolg heranzuhängen, gefällt mir diese Idee; sie hat etwas Verwegen-Verschlagenes, irgendwie Böses an sich, das zum Film und seinem ihm vorauseilenden Ruf passt, seinen Teil zum Gesamtkunstwerk beiträgt. Böse fiel im Übrigen auch der einmal mehr die Crystal-Lake-Idylle zerstörende Superschockeffekt am Schluss aus, der erst durch Savinis Wirken derart sinister ausfiel und Jason nicht nur sein erstes Gesicht gab, sondern auch ideale Voraussetzungen für eine Fortsetzung schuf. Gut so, denn
Slasher machen mit ihrer übersichtlichen Rezeptur, mit ihrer ebenso blutigen wie simplen Formel süchtig – wer empfänglich ist für ihren ganz bestimmten
Thrill, will ihn immer und immer wieder erleben.