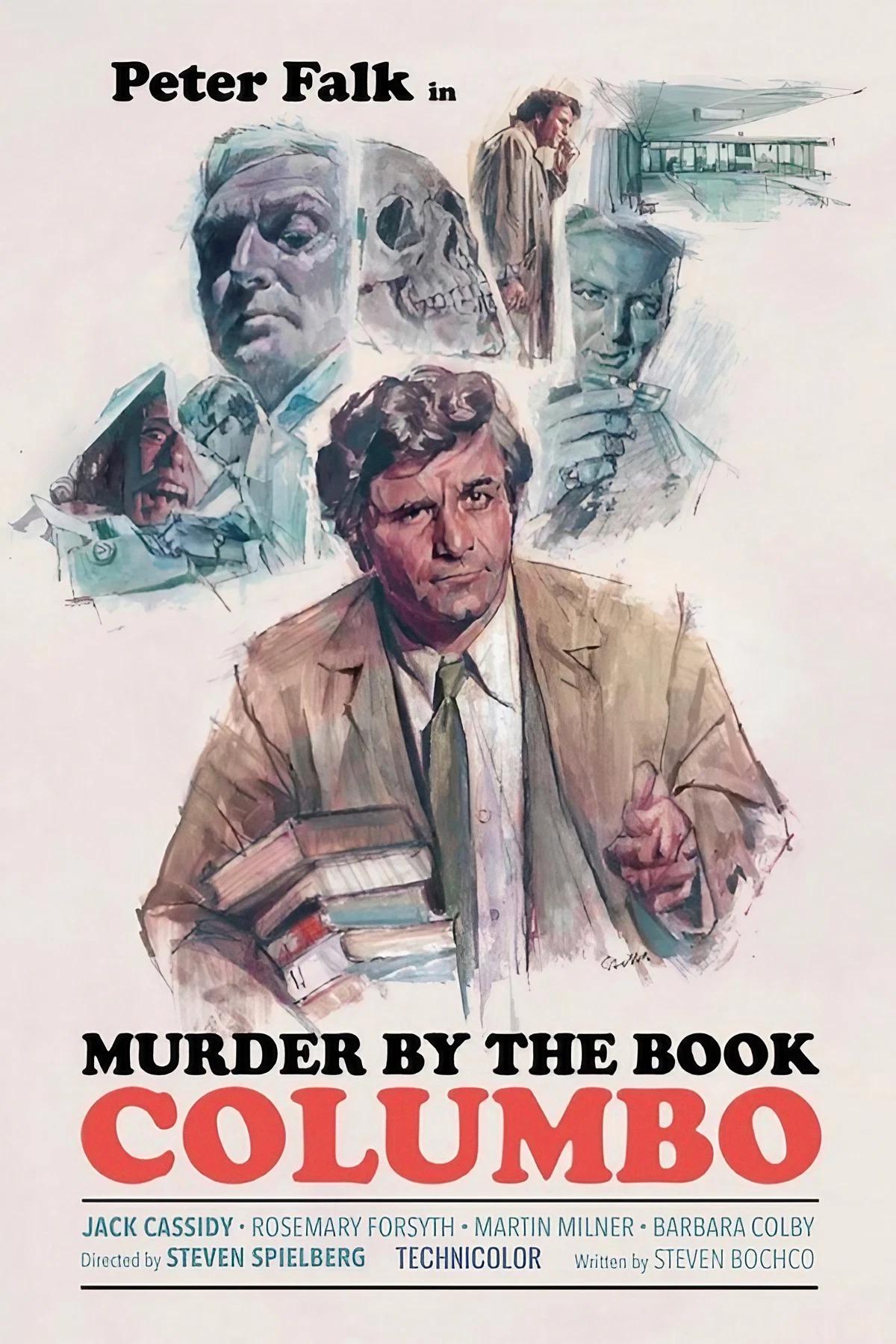Werk ohne Autor
„Vielleicht will ich doch kein Maler werden...“
Nach seinem Erfolg mit dem fragwürdigen Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“ floppte der zweite Kinofilm des deutschen Autorenfilmers Florian Henckel von Donnersmarck, die US-amerikanisch-französische Koproduktion „The Tourist“ aus dem Jahre 2010. Bis zur Veröffentlichung seines nächsten Spielfilms vergingen acht Jahre, in denen er sich auf das Erfolgskonzept seines Kinodebüts besann und sich thematisch der deutschen Geschichte widmete. Dabei orientierte er sich für sein über dreistündiges Monumentalwerk lose an der Biografie des bildenden Künstlers Gerhard Richter. „Werk ohne Autor“ startete am Tag der deutschen Einheit 2018 in den Bundeskinos und erhielt zwei Oscar-Nominierungen, u.a. für den „besten fremdsprachigen Film“. Zurecht?
„Niemals wegsehen!“
Nazideutschland im Jahre 1937: Der fünfjährige Kurt Barnert (Cai Cohrs, „Teufelsmoor“) wird von seiner junge Tante Elisabeth (Saskia Rosendahl, „Wir sind jung. Wir sind stark.“) zu einer Ausstellung über „entartete Kunst“ in Dresden mitgenommen. Ausstellungsleiter Heiner Kerstens (Lars Eidinger, „Babylon Berlin“) schwadroniert über die Abgründe des Kunstbetriebs und transportiert die NS-Ideologie, doch der kleine kunstinteressierte Kurt ist von den Ausstellungsstücken eher fasziniert denn abgeschreckt. Seine bildschöne Tante hingegen ist ein besonderes „Schmuckstück“ des BDM und damit gerade gut genug, dem „Führer“ bei dessen Besuch Dresdens einen Strauß Blumen zu überreichen. Doch Elisabeth ist psychisch labil und kommt mit diesem Druck nicht zurecht. Nach einem Nervenzusammenbruch kommt sie in psychiatrische Behandlung in der Anstalt Professor Carl Seebands (Sebastian Koch, „Das Leben der Anderen“), einem überzeugten Nazi, SS-Mitglied und Euthanasieverfechter. Auch Elisabeth wird zu seinem Opfer, er besiegelt ihre Ermordung.
Die junge DDR in den 1950ern: Kurt (jetzt Tom Schilling, „Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe“), inzwischen zum stattlichen jungen Mann gereift, verdingt sich als Maler von SED-Propagandamaterial – eine Verschwendung seines Talents, wie Kurts Vorarbeiter (Ben Becker, „Spiel um dein Leben“) nicht müde zu betonen wird. Irgendwann lässt sich der bescheidene Kurt dann doch davon beeindrucken und beginnt, Kunst an der Dresdner Universität zu studieren. Dort lernt er die Kommilitonin Ellie (Paula Beer, „Bad Banks“) kennen und lieben. Jedoch: Ihr Vater ist Professor Seeband, der Mörder seiner Tante. Gewissenloser Opportunist der dieser ist, hat er sich schnell mit den neuen Machtverhältnissen nach dem aus Nazi-Sicht verlorenen Zweiten Weltkrieg arrangiert, sich bei den Sowjets eingeschleimt und damit sogar seine Position als Anstaltsleiter zurückerlangt. Kurt weiß indes nicht, dass der Vater seiner Lebensgefährtin für den Tod seiner Tante verantwortlich ist. Er konzentriert sich auf sein Studium, das er überaus erfolgreich abschließt. Er beherrscht den Stil des sozialistischen Realismus perfekt und avanciert zum gefeierten Wandbildmaler. Ellie wird schwanger, doch ihr Vater will nicht, dass sie ein Kind von Kurt bekommt, und nimmt persönlich eine Abtreibung an seiner Tochter vor, mit der er zugleich ihre Fruchtbarkeit zerstört. Kurt und Ellie heiraten, doch weiß sie nichts davon, kein Kind mehr bekommen zu können.
Von einem Tag auf den anderen wirft Kurt seine Arbeit als Wandmaler hin und verlässt gemeinsam mit seiner Frau die DDR, um in der BRD an der Düsseldorfer Kunsthochschule unter Anleitung Professor Antonius van Vertens (Oliver Masucci, „Er ist wieder da“) mit absoluter Kunstfreiheit im Zuge der sexuellen Revolution und der ‘68er-Bewegung konfrontiert zu werden. Ein Kulturschock für Kurt auf der Suche nach seiner wahren künstlerischen Identität. In den Westen folgt ihnen Ellies Vater, der auch dort wieder eine Heilanstalt leiten darf. Wird sich Kurts Verhältnis zu seinem Schwiegervater normalisieren oder steht die große Eskalation noch bevor? Und wird es Kurt auch in der kapitalistischen BRD zum angesehenen Künstler schaffen?
Eine Zeitreise durch die deutsche Geschichte von der NS-Terrordiktatur über die DDR bis in die BRD der ‘68er-Zeit, exemplarisch durchexerziert anhand einer sich an Gerhard Richters Leben anlehnenden, gewissermaßen habfiktionalen Handlung, die zudem sehr persönliche Fragen nach der Suche nach einer eigenen Identität, Umgang mit der Vergangenheit, Schuld, Sühne und dem Versuch, eine Familie zu gründen und glücklich zu werden, behandelt – das sollte „Werk ohne Autor“ werden. Doch wie bereits bei „Das Leben der Anderen“ überwarf sich von Donnersmarcks Hauptquelle mit dem Regisseur und Drehbuchautor – in diesem Falle Gerhard Richter, der ihm bereitwillig Rede und Antwort gestanden hatte, im finalen Film jedoch lediglich ein bizarres Zerrbild seiner selbst erkannte, was ihn dazu bewog, sich vollumfänglich vom Endprodukt zu distanzieren.
Natürlich hat jeder Filmschaffende grundsätzlich das Recht, aus seinen Inspirationen das zu machen, was er will, künstlerische Freiheit auszukosten, dramaturgisch auszuschmücken oder zu verdichten, nach eigenem Gutdünken zu modifizieren. Dass ein Vorlagengeber beleidigt ist, wenn er in der Adaption sein eigenes Werk nicht mehr wiedererkennt, kommt immer mal wieder vor. Eines der prominentesten Beispiele dürfte „Shining“ sein, mit dessen Verfilmung durch Regiegenie Stanley Kubrick Autor Stephen King unzufrieden war, obwohl es sich bei beidem – Roman und Kinofilm – um Meisterstücke des jeweiligen Mediums handelt. Jedoch handelte es sich dabei um einen fiktionalen Stoff. Beruft sich jemand auf das ganz reale Leben eines Menschen und verzerrt es bis zur Unkenntlichkeit, ist die Kritik nachvollziehbar.
Vor allem dann, wenn ein Filmemacher derartig hohe Ansprüche an seine Arbeit stellt wie von Donnersmarck, der nicht einfach einen Unterhaltungsfilm machen, sondern Geschichtsaufarbeitung betreiben und sich vor der Kunst verneigen wollte – und dabei, kurioserweise weitestgehend unerkannt, krachend scheiterte. Seine Hauptrolle Kurt führt er als niedlichen Jungen mit großen blauen Kulleraugen ein, die bald, wie von Elisabeth angeraten, niemals mehr wegsehen, sondern jegliche bildende Kunst wissbegierig in sich aufsaugen. Diese Augen nehmen auch die Luftangriffe auf Dresden wahr, während seine Tante zusammen mit anderen Euthanasieopfern vergast wird. In die Diskussion, ob die gleichberechtigte Parallelmontage beider Ereignisse, die der Schnitt vornimmt, gerechtfertigt ist oder nicht, möchte ich mich gar nicht einklinken, sonderlich sensibel ist sie indes sicherlich nicht und auch leicht misszuverstehen.
„Sensibel“ wäre auch das vollkommen falsche Wort für die Inszenierung der schwierigen Geburt, bei der Seeband in Kriegsgefangenschaft hilft und anschließend einen Stein im Brett der Sowjets hat. Von Donnersmarck setzt auf plakative Bilder. Und auf Nacktszenen: Mehrere gekonnte Erotikszenen um Ellie vermischt er mit schwülstigem Gesäusel und lässt auch im weiteren Verlauf kaum eine Gelegenheit aus, sie unbekleidet zu zeigen und voyeuristisch von der Kamera abtasten zu lassen. Nun bin ich sicherlich der Letzte, der ein Problem mit erzählerisch begründeten Freizügigkeiten in Spielfilmen hätte. Jedoch findet die Figur Ellie außerhalb ihrer Nacktszenen kaum noch statt, wird also weitestgehend auf sie reduziert – als Ehefrau des Protagonisten wohlgemerkt! Das ist problematisch und womöglich ein Indiz für ein fragwürdiges Frauenbild von Donnersmarcks, das er bereits in „Das Leben der Anderen“ unter Beweis stellte. Dabei hätte die Rolle viel mehr hergegeben – doch die Folgen der Abtreibung beispielsweise werden weitestgehend übergangen und bleiben unaufgearbeitet. Von Donnersmarck scheint sich schlicht nicht für diese Sorte weiblicher Befindlichkeiten zu interessieren.
Das generelle Schweigen zu Vergangenem in „Werk ohne Autor“ könnte als Allegorie auf die bis zur ‘68er-Revolte ausgebliebene Aufarbeitung von Kriegstraumata und kritische Kommunikation mit der Elterngeneration gedacht sein, was aber reine Spekulation ist, da der Film sich dazu auch im weiteren Verlauf nicht äußert und keine Haltung erkennbar werden lässt. Dass die DDR ein höchst verlassenswerter Ort gewesen sei, setzt von Donnersmarck offenbar voraus, denn weshalb genau dies der Fall gewesen sein soll, wird gar nicht erst verhandelt. Die Darstellung der Düsseldorfer Kunstakademie wirkt wie eine überzeichnete Persiflage auf eine geistig freie, entfesselte und sich ausprobierende Nachwuchsszene. Das wirft die Frage auf, ob von Donnersmarck sie deshalb auf diese Weise inszenierte, um dem, wie er selbst über sie denkt, Ausdruck zu verleihen. Jedenfalls dürfte sich manch einfacher gestrickte Zuschauerin oder Zuschauer angesichts dieser Bilder fragen, ob der Nazi mit seinen inbrünstigen Tiraden gegen „entartete Kunst“ nicht doch vielleicht ein bisschen recht hatte. Mit den brennenden Wahlplakaten hat der Akademieleiter immerhin einen beeindruckenden Auftritt, wenngleich der ihm innewohnende Aufruf zur apolitischen künstlerischen Existenz mindestens diskussionswürdig ist…
Unfreiwillig komisch sind die absurden Rückblenden zu den Kriegserfahrungen des Akademieleiters. Die Entstehung der Kunst Kurts zu beobachten ist durchaus erfreulich und interessant, die daraus resultierende Pointe jedoch hanebüchen. Nachdem Seeband in die BRD „rübergemacht“ hat, wird er endgültig zur gesamtdeutschen Metapher für die willfährige Kollaboration mit Naziverbrechern nach Kriegsende, wobei diesbezüglich kaum eine Differenzierung zwischen DDR und BRD stattfindet. In ihrer Omnipräsenz ist diese Figur aufwühlend und ihre Möglichkeiten zur Einflussnahme wirken beunruhigend, wie eine permanent im Hintergrund lauernde Gefahr. Diese Charakterisierung ist recht gut gelungen. Ein paar mehr oder wenige subtile Verweise auf Kunst und Literatur sowie Reminiszenzen an Roland Barthes („Der Tod des Autors“) erfreuen den bildungsbürgerlichen Teil des Publikums. Weitere Pluspunkte des Films sind seine bemerkenswerte Optik und sein hochkarätiges, engagiertes Ensemble.
Mehr Positives kann ich „Werk ohne Autor“ aber leider nicht attestieren. Sein Humor ist arg gefällig, Max Richters emotionalisierende Filmmusik penetrant und das Finale geradezu eine Frechheit: Ellie kann plötzlich doch schwanger werden, warum auch immer, ein Happy End inklusive Paula Beers obligatorischer Splitterfasernacktszene. Und von Donnersmarck setzt noch einen drauf, ein noch happigeres Happy End – der Film findet kein Ende. Etliche Wiederaufnahmen und Wiederholungen durchziehen die Handlung bis zum Schluss; das Publikum muss nicht mitdenken, sondern wird auf alles mit der Nase gestoßen. Doch worauf eigentlich? „Werk ohne Autor“ ist in erster Linie eine heillos überkonstruierte, plakative und klischeelastige Aneinanderreihung von Was-zur-Hölle-Momenten, die mit Geschichtsaufarbeitung nicht viel zu tun hat – und mit Gerhard Richter anscheinend ebenso wenig, siehe oben. Von Donnersmarck wildert in der deutschen Geschichte für melodramatischen, überzeichneten Kitsch und betreibt Manipulation bis hin zur Geschichtsverfälschung, muss stets zentimeterdick auftragen und liefert einen erschreckend, ja, geradezu absurd unpolitischen Film ab, dessen Inkompetenz breiten Teilen der Kritik und des Publikums offenbar gar nicht wahrnehmen. Ein überambitionierter Filmemacher mit dem dicken Kunststempel im Anschlag und eine indifferente, bürgerliche deutsche Öffentlichkeit – da haben sich anscheinend die Richtigen gefunden. Ein Ärgernis der jüngeren deutschen Kinogeschichte.