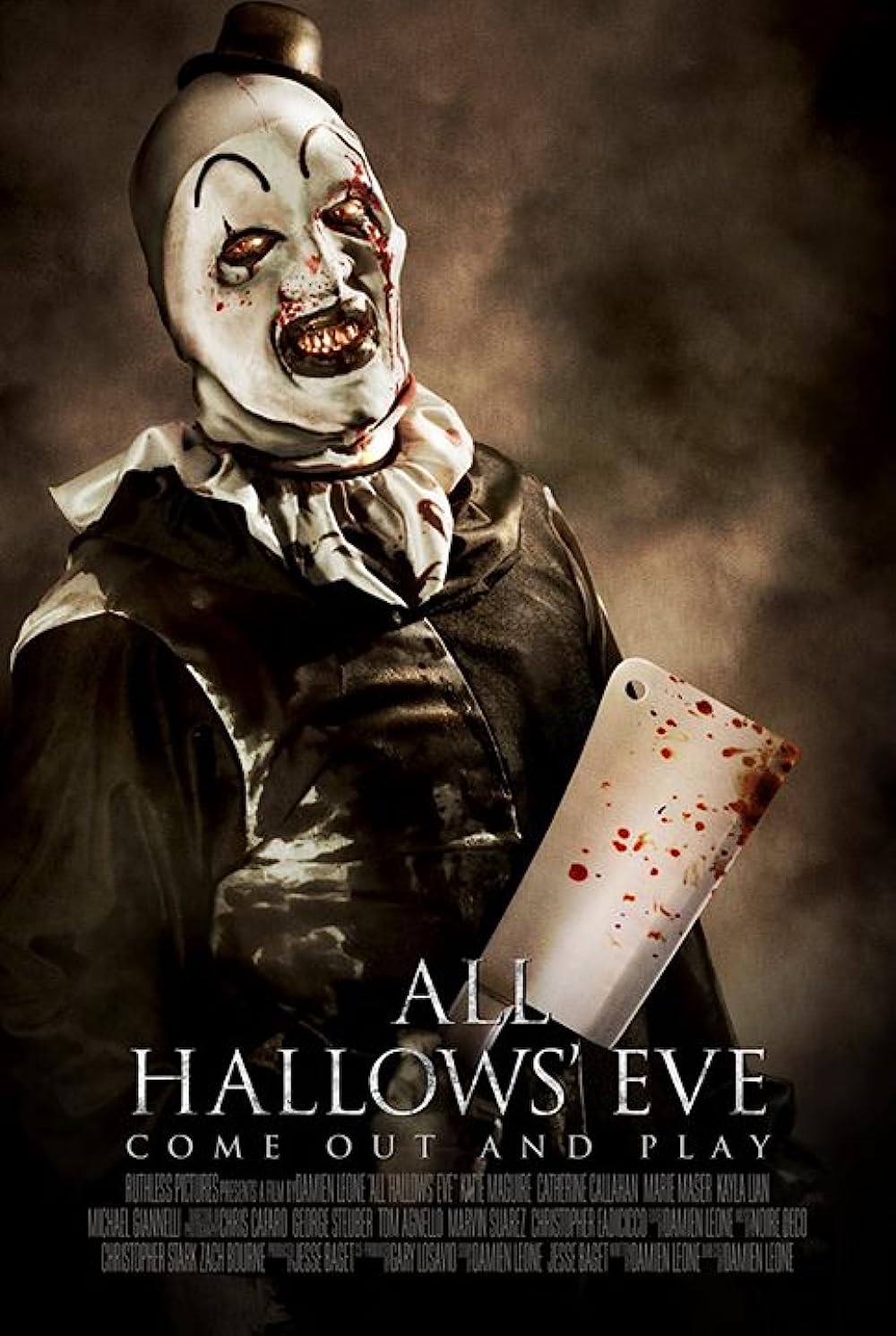Baby Love
„Ich möchte nie alt und hässlich werden!“
Die Verfilmung des gleichnamigen (mir unbekannten) Romans Tina Chad Christians erfolgte auf Grundlage einer Drehbuchadaption, an der gleich fünf Autoren beteiligt waren, und wurde im Jahre 1968 vom Schotten Alastair Reid („Das Haus der Schatten“) inszeniert. Im März 1969 lief „Baby Love“ in US-Kinos an und passte mit seinen Freizügigkeiten zum neuen Zeitgeist nach der sexuellen Revolution, bedient sich als Coming-of-Age-Drama mit Lolita-Thematik und erotischen Anleihen aber auch eines besonders problematischen Themas.
Während die 15-jährige Luci (Linda Hayden, „Wie schmeckt das Blut von Dracula?“), die gerade zaghaft das andere Geschlecht für sich entdeckt, nach der Schule mit einem Jungen knutscht (und auf dem Nachhauseweg noch einen Rentner foppt), begeht ihre Mutter Liz (Diana Dors, „Das Dunkel der Nacht“) Selbstmord. Luci findet ihre tote Mutter und wird anschließend von deren Ex-Freund Robert (Kevin Barron, „Der sechste Kontinent“), einem erfolgreichen und wohlsituierten Londoner Arzt, in dessen Familie aufgenommen. Dort ist Luci zunächst sehr unglücklich und leidet unter Halluzinationen und Alpträumen. Ihre neue Stiefmutter Amy (Ann Lynn, „Das Grauen auf Black Torment“) kümmert sich jedoch aufopfernd und liebevoll um sie und ist sehr verständnisvoll. Sohn Nick (Derek Lamden, „The Scarlet and the Black“) beginnt, sich zu Luci hingezogen zu fühlen, und sogar Amy scheint eine stärkere Zuneigung zu Luci als zu ihrem Mann zu entwickeln. Doch Luci hat andere Interessen…
„Baby Love“ mischt Motive aus Vladimir Nabokovs „Lolita“ und Pier Paolo Pasolinis „Teorema – Geometrie der Liebe“ mit eigenen Ideen und erzählt die Geschichte vornehmlich aus Lucis Perspektive. Regisseur Reid und Kamerachef Desmond Dickinson sind immer wieder stark um eine einzigartige Optik bemüht, inszenieren Lucis Zubettgehen als für sie furchterregende Konfrontation mit den Einrichtungsgegenständen und bedienen sich schneller Zooms und Fischaugenperspektiven, später grüner Farbfilter. Den 15-jährigen Mittelpunkt des Interesses, die von der damals tatsächlich erst 15- oder 16-jährig debütierenden Linda Hayden gespielte Luci, geht mit Amy Klamottenkaufen und zeigt sich davon begeistert – und in Unterwäsche. Mit Nick geht sie ins Kino, wo sie ein älterer Mann belästigt, was sie sich zu Nicks Entsetzen gefallen lässt. Daraufhin knutscht sie mit Nick, der – und damit auch das Publikum – sie abends zuhause nackt von hinten sieht. Beim Besuch eines Rockkonzerts gibt’s die obligatorischen Tanzszenen; und als sie dort Männer kennenlernt, zerrt der eifersüchtige Nick sie raus, womit sich die Kinoszene gewissermaßen wiederholt.
Die Momente, in denen Luci Haut zeigt, werden also eingeordnet in eine Charakterisierung der Beziehung zwischen ihr und Amy sowie Nick, die in erster Linie einhergeht mit mehr oder minder typischer Teenager-Freizeitgestaltung. Zweifelsohne ist Linda Hayden ein bildhübsches, gut entwickeltes junges Fräulein, von Sexploitation kann hier lange Zeit aber keine Rede sein. Je nach Sicht- und Auslegungsweise mag sich dies ändern, wenn sie sich beim Sonnenbanden oben ohne zeigt, wenngleich diese Szene untermauern soll, wie naiv und spielerisch sie mit ihren Reizen umgeht. Stiefvater Robert ist zunehmend genervt, während Sohnemann Nick scharf auf Luci ist, sie ihn aber immer wieder abblitzen lässt. Auch bis hierhin quasi ein gutes Stück weit Teenagerinnen-Normalität und Luci als sich ausprobierende und Grenzen auslotende Göre mit den dazugehörenden Gefühlschwankungen.
Dies wird sich im weiteren Verlauf radikal ändern, wobei als Ausgangspunkt Stiefmutter Amys ungewöhnliches Interesse an Luci betrachtet werden kann. Den eigentlichen Wendepunkt – die Situation eskaliert, nachdem sich Luci erfolglos Robert hinzugeben versucht hat –, mag man als geschmacklos empfinden, doch macht er aus „Baby Love“ einen gruseligen Psycho-Thriller, der auf ein leider eher unpassendes offenes Ende zusteuert. Zumindest bietet „Baby Love“ einigen küchenpsychologischen Interpretationsspielraum und unterhält über die gesamte Zeit in seinen konfliktarmen Szenen ohne nennenswerte Längen angenehm leicht, um in anderen traurig zu stimmen, Spannung zu erzeugen, zu irritieren oder zu verstören. Von der jungen Hayden ist das alles stark geschauspielert, womit sie sich für weitere europäische Genre-Produktionen, vornehmlich im Horrorbereich, empfahl.
Vorsichtige 6,5 von 10 Tänzchen im Rockschuppen für „Baby Love“, vorbehaltlich einer leichten Korrektur nach oben, sofern das Ende im Zuge einer etwaigen Neusichtung doch noch einen besonderen Aha-Effekt bei mir erzeugt.