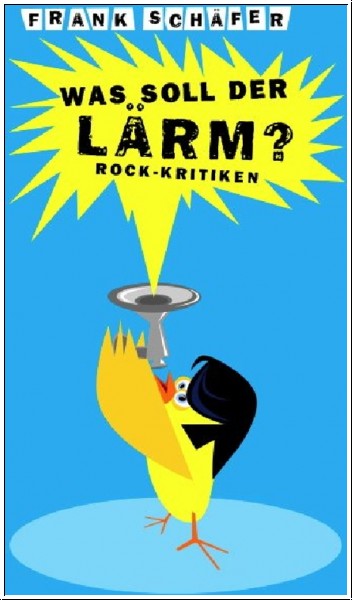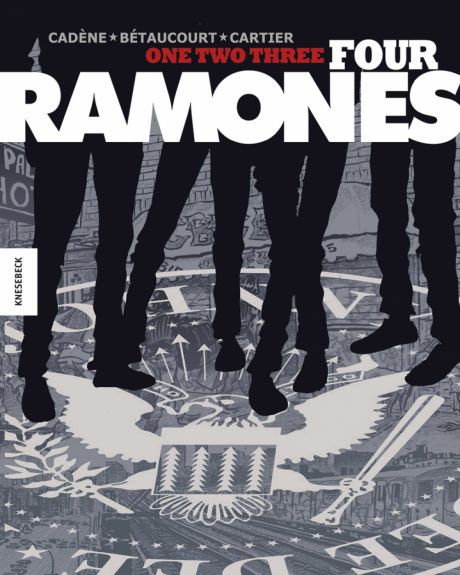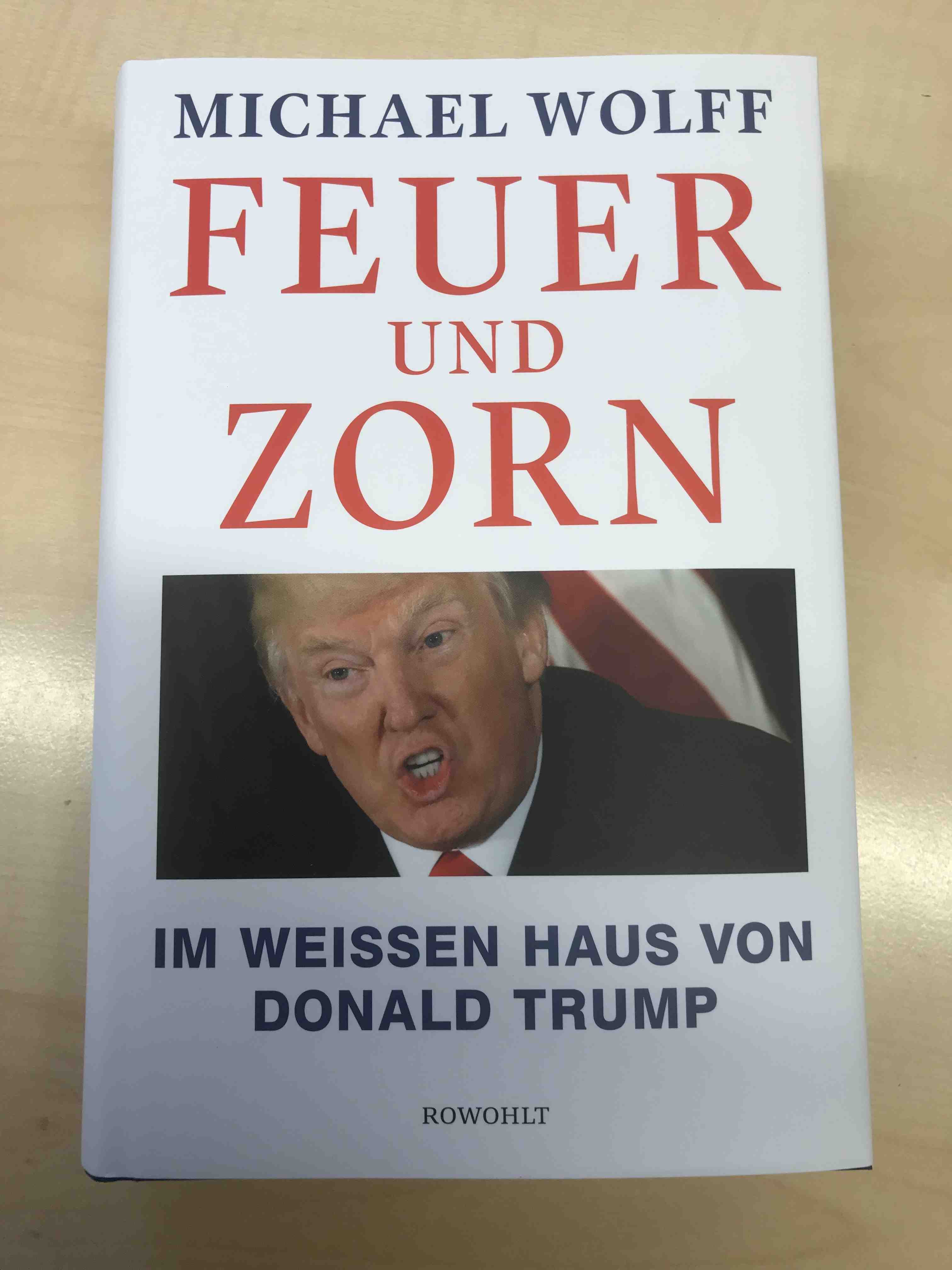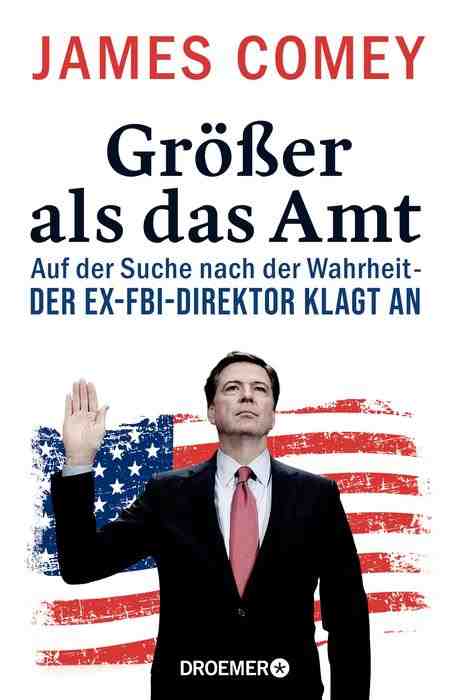Andreas Hock – Bin ich denn der Einzigste hier, wo Deutsch kann? Über den Niedergang unserer Sprache
Der ehemalige Chefredakteur der Nürnberger Abendzeitung Andreas Hock veröffentlichte 2014 nach seinem Trash-Debüt, genauer: einer Biographie über die idiotischen neureichen Prolls Carmen und Robert Geissen, einem Buch über Panini-Bilder sowie einem Begleitband zur Nerd-Sitcom „Big Bang Theory“ im Jahre 2014 die sich mit dem Verfall der deutschen Sprache auseinandersetzende, rund 190 Seiten umfassende Polemik „Bin ich denn der Einzigste hier, wo Deutsch kann?“ im Riva-Verlag. Zwischendurch gab es jedoch bereits ein Werk namens „Like mich am Arsch – wie unsere Gesellschaft durch Smartphones, Computerspiele und soziale Netzwerke vereinsamt und verblödet“, dessen Titel Hocks konservativen Kulturpessimismus bereits erahnen lässt.
So schlägt er mit seinem in zahlreiche kurze Kapitel unterteilten, zum Bestseller avancierten Buch dann auch voll in diese Kerbe: Jedes Kapitel ist – nach einem Vorwort Dr. Hellmuth Karaseks, das vermuten lässt, er habe das Buch gar nicht gelesen – mit einem angenommenen Grund für Hocks im Titel aufgestellte These überschrieben, von
„Weil uns schon am Anfang der Spaß verging“ über
„Weil Disney mehr Bumm! war als Dürrenmatt“ bis hin zu
„Weil wir zu zwitschern begannen“. Dahinter verbergen sich neben zumindest teilweise durchaus zutreffender Kritik an Schulsystem und Lehrplänen sowie einigen interessanten, bisweilen jedoch sicherlich auch strittigen Ausflügen in die Historie der Sprachentwicklung u.ä. vor allem exemplarisch herangezogene Beispiele für Vergewaltigungen der deutschen Sprache: durch Beamtendeutsch, Politikerrhetorik und von zum Teil sogar falschen Anglizismen durchsetztes Vokabular der Werbe-Branche und der Wirtschaft mit ihren „Managern“ im Allgemeinen, wovon auch ich ein (Klage-)Lied singen kann – sitzt man doch im von Halbwissen und Jugendwahn bestimmten marktschreierischen „Marketing“ ebenso häufig wie im ebensolchen Entscheidungs- und Führungsbereich von Unternehmen dem Irrglauben auf, Amerikanisierung sei „cool“ sowie Ausdruck von Modernität und Innovation. So stolpert man von einer missglückten, sinnbefreiten „denglischen“ Floskel zur nächsten über die Stolpersteine der Sprachdurchmischung, dass es nur noch peinliche Schaumschlägerei ist.
Doch all das ist nicht neu und wurde zu Recht schon häufig kritisiert – ob in ähnlichen Büchern oder in anderen Medien. An den charmanten Witz eines Bastian Sick reicht Hock jedoch kaum heran, auch scheint er keinen Bildungsauftrag zu verfolgen: Wo Sick freundlich erklärt, wie man es besser bzw. richtig mache, bleibt Hock polemisch und wenig konstruktiv. Das wäre vielleicht gar nicht so schlimm, würde er nicht immer wieder sein arg konservatives Weltbild durchklingen lassen, das beispielsweise zu einer fürchterlich pauschalen, viel zu undifferenzierten Abwatschung der sog. ‘68er führt. Die Antwort darauf, wo das Problem bei aller angebrachten Kritik am „Gendering“ bei der Verwendung von Doppelformen à la „Leserinnen und Leser“ liegen soll, bleibt er schuldig, mit wenig deutschen Begriffen wie „Dokutainment“ oder „Genre“ hat Hock hingegen keinerlei Berührungsängste, was wie ein Widerspruch zu manch Kapitel erscheint und ihn einer ähnlichen Wischiwaschi-Einstellung wie derjenigen, die er kritisiert, verdächtig macht – und dass er auch die vernünftigen Aspekte der jüngsten Rechtschreibreformen pauschal niedermacht, entbehrt nun wirklich jeglicher Sachlichkeit. Seine eigene Orthographie ist indes auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Insbesondere die Trennung von Haupt- und Nebensätzen durch satzabschließende Punkte stößt mir immer wieder auf, die mir einer fragwürdigen Journalismusschule zu entspringen scheint, in der lange Sätze pauschal als Teufelswerk diskreditiert werden.
Dass Begriffe wie „absegnen“ oder „abnicken“ aus dem von Hock in erster Linie wegen dessen Bürokratiesprache vorgeführten DDR-Deutsch kämen, wage ich einfach mal zu bezweifeln, doch das ist natürlich ein Detail. Weshalb sich
„selbst ein sprachlich hochbegabter Schüler kaum“ von Kafka
„wach küssen“ lassen könne, erschließt sich mir jedoch überhaupt nicht. Ich halte diese Behauptung für ausgemachten Quatsch, Hocks vermutlich verquerem Geschmack entsprungen. Blogs als „neumodischen Unsinn“ abzutun, ist wiederum eine bodenlose Unverschämtheit und ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die das Netz um lesenswerte, bisweilen ausführlichere und besser recherchierte, weil keinerlei Print-Beschränkungen unterliegenden, Inhalte erweitern. Sieht da ein konservativer Print-Journalist evtl. seine Felle davonschwimmen?
Abschließend bleibt anzumerken, dass Hocks Battle gegen Gangsta-Rap bischn lame ist, da wäre mehr gegangen. Immerhin gelingt ihm aber ein versöhnlicher Abschluss, wenn er im letzten, wie ein Anhang wirkenden Kapitel altertümliche, aus dem Sprachgebrauch beinahe oder bereits komplett verschwundene Begriff in Umgangs- und Jugendsprachsätze integriert, was mich dann doch ziemlich schmunzeln ließ. Letztendlich ist Hocks Pamphlet als polemischer, in harschem Ton verfasster Überblick über die schlimmsten Sprachpanscher durchaus gut zu gebrauchen. Dass zwischenzeitlich immer wieder bedenkliche Fortschrittsfeindlichkeit, politischer Konservatismus und wutbürgerliche Ignoranz durchscheinen, ist jedoch befremdlich – insbesondere vor dem Hintergrund, dass Hock aus dem Bereich der bürgerlichen Presse und der Klatschschreiber stammt sowie als CSU-Pressereferent tätig war und damit zur allgemeinen Verblödung sicherlich selbst seinen Anteil geleistet hat.