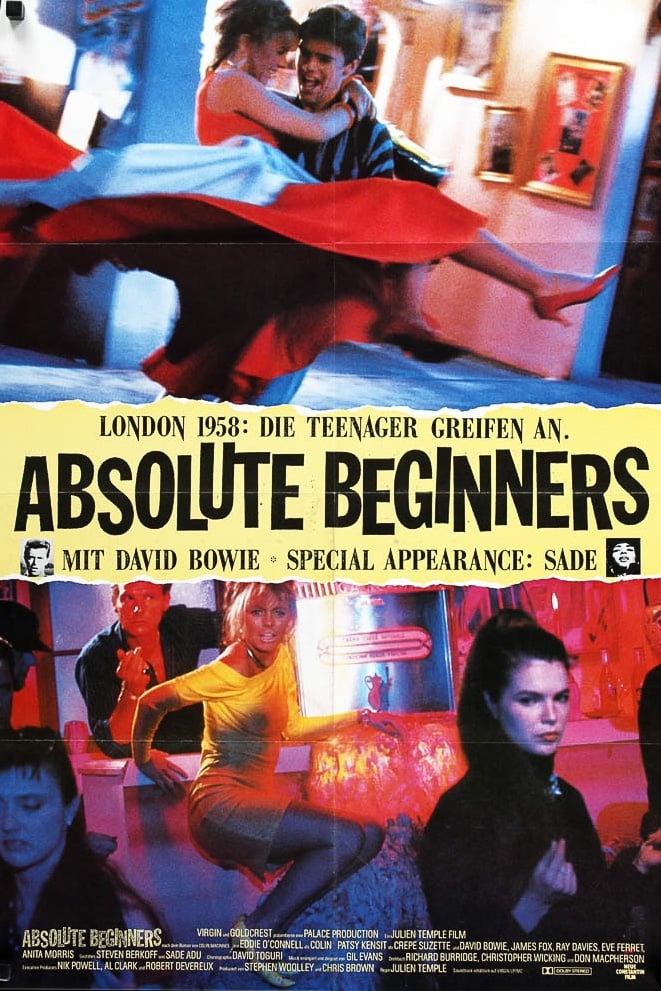Barfly
Henry Chinaski (Mickey Rourke) ist ein Trinker und gleichzeitig ein begabter Dichter. Als er in einer Bar die ebenfalls alkoholabhängige Wanda (Faye Dunaway) kennenlernt, findet er eine Freundin, die ihn versteht. Wenig später entdeckt die Verlegerin Tully (Alice Krige) Henry als außergewöhnliches Talent. Plötzlich wird er als Dichter erfolgreich, doch das Trinken läßt ihn nicht los.
„Was trinkst du?“ – „So ziemlich alles!“
US-Gossenkultautor Charles Bukowski entwickelte Anfang der 1980er zusammen mit dem gebürtig iranischen Regisseur Barbet Schroeder („Weiblich, ledig, jung sucht...“) das Drehbuch zu „Barfly“, einem Film, der nach Finanzierungsschwierigkeiten 1987 endlich erschien und Bukowskis Alter Ego, Trinker und Gelegenheitsschriftsteller Henry Chinaski von Mickey Rourke („The Wrestler“) gespielt in eine alkoholgeschwängerte Romanze mit Wanda (Faye Dunaway, „Network“) schlittern zeigt.
Im Leuchtreklamengossenambiente des Los Angeles der 1980er sitzt Chinaski beinahe jeden Tag am Tresen seiner Stammkneipe, trinkt einen nach dem anderen und prügelt sich mit dem verhassten Macho-Barkeeper Frank Stallone („Rocky“). Dass er dabei ständig verliert, scheint ihm nichts auszumachen. Eines Nachts gewinnt er dann aber doch mal und lernt daraufhin die attraktive Wanda kennen, die ebenfalls regelmäßig dem Alkohol zuspricht. Man verliebt sich ineinander und zieht zusammen, woraufhin sich bizarre Szenen abspielen – insbesondere, nachdem sie Henry ausgerechnet mit Eddie betrügt und Henry wiederum von Verlegerin Tully (Alice Krige, „Stephen King’s Schlafwandler“) aufgesucht wird, die nicht nur seine Geschichten drucken, sondern ihn auch dazu überreden will, mit ihr ein neues, vermeintlich besseres Leben anzufangen...
Auf den ersten Blick mag die Handlung unpointiert und beliebig erscheinen, doch das täuscht. „Barfly“ bricht eine Lanze für Alkoholiker, für das Leben am Rande der Gesellschaft, für Leistungsverweigerer und „Verlierer“, indem man Mickey Rourke ambitioniert und enthusiastisch einen Trinker spielen lässt, der unter seiner Situation keinesfalls leidet, sondern sie spitzbübisch genießt. Henry Chinaski steht über den Dingen, seine Pleiten und Pannen können ihm nichts anhaben, da er sie vor niemandem zu rechtfertigen braucht, schon gar nicht vor den Idioten um ihn herum, deren bemitleidende oder verächtliche Blicke ihn nicht kränken oder in seinem Stolz verletzen können, sondern in seinem Lebensentwurf eher noch bestätigen. Chinaski ist cool, er inszeniert seinen allabendlichen Absturz mit Stil, Würde, Humor und dem Stolz eines aufrichtigen Trinkers in einer Welt, für die sich ein bürgerliches, nüchternes Leben nicht lohnt. Nicht das Leben lacht über Chinaski, Chinaski lacht über das Leben.
Ja, „Barfly“ ist voll von augenzwinkerndem, selbstironischem bis zynischem Humor, der Chinaskis Spaß an seinem Leben, das doch eigentlich so problembehaftet sein sollte, porträtiert. Das ändert sich erst durch die Beziehung mit Wanda, die es schafft, ihn zu verletzen. Als er jedoch die Möglichkeit bekommt, ein luxuriöses Leben mit Tully zu führen, entscheidet er sich bewusst dagegen und für sein gewohntes Umfeld sowie Wanda, die gerade Tully verprügelt. Sein Geld, das er für seine Geschichten bekommen hat, vertrinkt er mit seinen „Freunden“ in der Kneipe und freut sich auf die nächste Schlägerei mit dem widerwärtigen Schnauzbartproll Eddie. Diese bewusste Entscheidung für exakt dieses Leben, ganz ohne Reue, Scham oder Verbitterung, ist die Pointe unter Schroeders und Bukowskis Zusammenarbeit, die möglicherweise von denjenigen Zuschauern, die von einem Trinkerfilm pädagogische oder moralistische Aussagen erwarten, als vollkommen unverständlich aufgenommen bzw. gar nicht wahrgenommen wird.
Auf der anderen Seite ist Chinaski eben gar kein „typischer Alkoholiker“. Er hat auf gewisse Weise seinen Konsum im Griff, erleidet keinen in seinen Konsequenzen schlimmen Kontrollverlust, erfährt keinen Leidensdruck. Er hat die mal mehr, mal weniger verlockend mit Geld, Ansehen und Gesundheit wedelnde Welt aufgegeben, nicht sich selbst. Er ist mit sich im Reinen und davon überzeugt, kein schlechteres, sondern schlicht ein anderes Leben zu führen. Das unterscheidet ihn von zahlreichen Alkoholikern und macht „Barfly“ dadurch zwar keinesfalls zu einem glorifizierenden Werk, aber doch zu einem, dessen Aussage differenziert betrachtet werden sollte und keine Allgemeingültigkeit beinhaltet.
Mickey Rourkes Schauspiel zwischen exaltiert und besonnen bereitet ihm sichtlich Freude. Auch optisch wurde er für seine damals für ihn ungewöhnliche Rolle passend zurechtgemacht, wenn man auch anhand Bukowskis Literatur eigentlich einen älteren Charakter mit Chinaski verbindet. Hin und wieder erinnert mich sein Schauspielstil in „Barfly“ an den eines Jack Nicholsons, den ich mir auch gut für die Rolle hätte vorstellen können. Faye Dunaway bewies ebenfalls Mut für eine außergewöhnliche Rolle – zwar keinen zur Hässlichkeit, aber immerhin zu einem gegen ihr Image gebürsteten Charakter. Schroeders Regie setzt beide eindrucksvoll in Szene und hievt den Film auf ein auch rein handwerklich gehobenes Niveau, das die richtige Stimmung vermittelt. Für das, was Barfly sein will – nämlich eben
kein betroffen machendes Sozialdrama oder Chronik eines alkohol-/drogenbedingten Zerfalls – ist „Barfly“ überaus gelungen, eine interessante, alternative Betrachtungsweise gegen gängige Klischees und bringt Bukowskis eigenen lockeren Umgang mit der Thematik gekonnt auf die Leinwand. Dieser hat es sich übrigens nicht nehmen lassen, einen kleinen Cameo-Auftritt als Kneipengast hinzulegen, für den er natürlich kein schauspielerisches Talent benötigte.