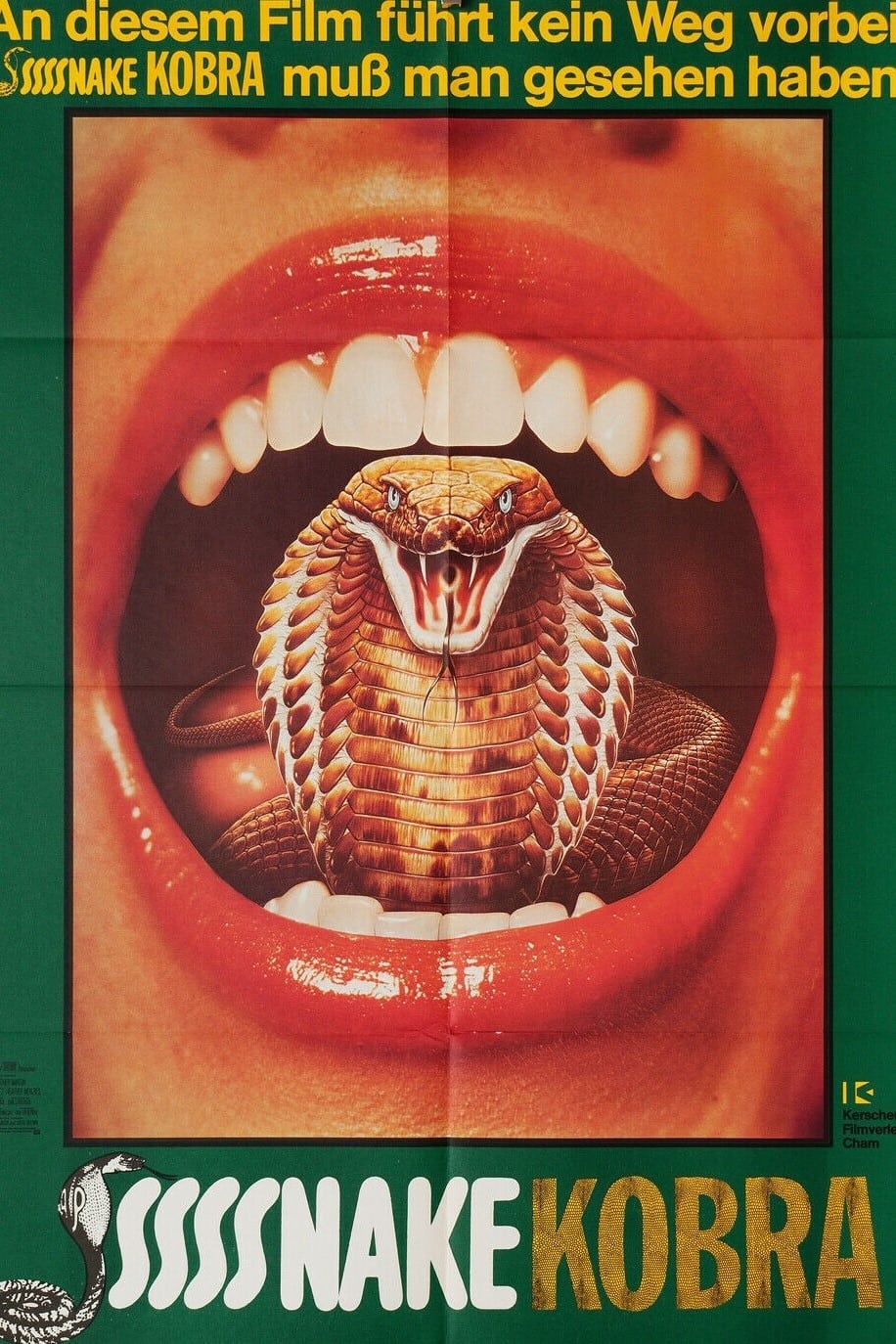Der kleine Horrorladen
Mit Musicals und somit auch Musical-Filmen kann man mich normalerweise jagen, sind sie doch in der Regel ein Garant für den absoluten Kitsch-Overkill. Da wird aus allem eine schwülstige Sing- und Tanznummer gemacht und jede Geschichte bis zur Unkenntlichkeit durch den Familientauglichkeitsfleischwolf gedreht, glattgebügelt bis zum Gehtnichtmehr. Pomp und Oberflächlichkeit gehen miteinander einher und schamlos werden alle Klischees totgeritten, dass sich mir bei „Grease“ & Co. der Magen umdreht.Mr. Mushnik (Vincent Gardenia) hat mit Abstand den miesesten Blumenladen in der ganzen Stadt. Sein Gehilfe Seymore (Rick Moranis) schmachtet in seinem Kellerzimmer nach der kessen Verkäuferin Audrey (Ellen Green). Die wiederum verzehrt sich nach dem sadistischen Zahnarzt Orin Scrivello (Steve Martin). Alles geht seinen Gang, nichts läuft, bis Audrey II auftaucht, eine niedliche Pflanze die bald zum Einfamilienhaus-Format heranwächst. Das Geschäft blüht und Audrey II wartet groß, grün und gefräßig auf Menschenfleisch...
Doch gibt es einige wenige Produktionen, die andere Wege beschreiten und ich daher von meiner Warte aus als „Anti-Musicals“ bezeichnen möchte. Zum einen wäre da beispielsweise die „Rocky Horror Show“, die die immer stark homophil anmutenden Geschmacksverirrungen gängiger Musicals grotesk überzeichnet und eine bizarre, in allen Belangen übers Ziel hinausschießende Edeltrash-Transvestitenparty zelebriert. Ein weiterer, mir sehr an Herz gewachsener Vertreter ist „Der kleine Horrorladen“, eine Verfilmung des gleichnamigen Musicals, das wiederum auf Roger Cormans schrägem B-Movie „Little Shop of Horrors“ aus dem Jahre 1960 basiert. Der Film stammt aus dem Jahre 1986 und die Regie führte niemand Geringerer als der neben Jim Henson zweite Muppets-Vater Frank Oz, der zuvor darüber hinaus mit Henson bereits das sehr gelungene, ernsthaftere Fantasy-Abenteuer „Der dunkle Kristall“ realisierte.
Zeitlich in den ausklingenden 1950er Jahren angesiedelt, wird die Geschichte einer außerirdischen Pflanze erzählt, die einem chronisch erfolglosen Blumenladen in einem unwirtlichen Viertel einer US-amerikanischen Großstadt zu Ruhm und Erfolg verhilft, sich aber bald als fleischfressendes, rasant wachsendes Ungetüm entpuppt, das vom trotteligen Loser Seymour (Rick Moranis, „Ghostbusters“), der sich von Ladenbesitzer Mr. Mushnik (Vincent Gardenia, „Der Himmel soll warten“) ausbeuten lässt, regelmäßig gefüttert werden will. Seymour wiederum ist unglücklich verliebt in seine Kollegin Audrey (Ellen Green, „Jung, weiblich, gnadenlos“), tauft die Pflanze kurzerhand „Audrey II“ und wittert seine Chance, doch noch bei „Audrey I“ zu landen. Doch diese ist mit dem sadistischen Zahnarzt Orin Scrivello (Steve Martin, „Bowfingers große Nummer“) liiert...
Ja, in prächtigen Kulissen steigert „Der kleine Horrorladen“ zahlreiche 50ies-Klischees bis ins Absurde, seien es die Geschlechterrollen oder soziale Hierarchien und selbstverständlich die phantastischen B-Movies jener Zeit, und überzeichnet seine Charaktere zu wandelnden Reliefs grober Skizzierungen, aus denen die Protagonisten moderner Märchen sind. Da wird Seymour vom geizigen, ausbeuterischen Mr. Mushnik aus dem Waisenhaus geholt und ergibt sich widerspruchslos in sein trauriges Schicksal, da lispelt Audrey als naives Blondchen und träumt später mit Seymour von einem den spießigen „Pleasentville“-Vorstellungen des Jahrzehnts entsprechenden Eheleben und da wird Seymour vom erbarmungswürdigen Verlierer zum gefragten Mann – und eben zum Mörder.
Denn im Prinzip ist „Der kleine Horrorladen“ eine Horrorkomödie, immerhin werden hier Menschen an eine außerirdische Lebensform verfüttert. Blut und Innereien bekommt man aber natürlich nicht zu sehen; stattdessen erfreut man sich an einer (bzw. strenggenommen waren aufgrund ihres Wachstumsprozesses mehrere) aufwändig manuell animierten Pflanzenpuppe, die nie unbeweglich wirkt, sondern der Oz mit seiner diesbezüglichen Erfahrung menschliche Züge einhauchte und ein bizarres Wesen schuf, das den teils anarchisch wirkenden Muppets in nichts nachsteht bzw. sie sogar noch übertrumpft. Und spätestens, wenn „Audrey II“ gemäß des Musicalkonzepts selbst zu singen beginnt, bleibt kein Auge trocken. Drei dunkelhäutige Mädels tauchen immer wieder unvermittelt auf, führen singend durch die Handlung und verdeutlichen bereits zu einem frühen Zeitpunkt, auf welch hohem Niveau sich das musikalische Repertoire dieses Films befindet. Soulige und rock’n’rollige Nummern gehen nicht nur ins Ohr, sondern auch ins Bein und werden perfekt choreographiert von den Charakteren mit unvergleichlicher Spielfreude vorgetragen. Die Songs sind hier kein langweiliges Füllmaterial, sondern unvergessliche Höhepunke, technisch einwandfrei, wortgewandt und -witzig und zum Teil herrlich schrill.
Beispielsweise sei an Steve Martins unnachahmliche Darbietung „Son, be a Dentist“ erinnert, der seinen Part inbrünstig als lachgassüchtiger Sado-Zahnarzt interpretiert und Bill Murray („Und täglich grüßt das Murmeltier“) als masochistischen Patient bekommt. Weitere Nebenrollen wurden mit nicht minder bekannten Namen wie John Candy („Ferien zu dritt“) und James Belushi („Der Verrückte mit dem Geigenkasten“) besetzt. Getragen jedoch wird „Der kleine Horrorladen“ vorrangig von Rick Moranis in seinem Zusammenspiel mit der furiosen Pflanzenkreatur, was entscheidend dazu beiträgt, dass Frank Oz’ Film von der ersten bis zur letzten Sekunde kurzweilige, extrem humorvolle Unterhaltung auf hohem Absurditäten-Niveau und mit der gewohnten Detailverliebt- und sympathischer Verrücktheit bietet, die ihn zur aberwitzigen Musical-Karikatur, in jedem Falle aber zum Kultfilm machen, den jeder mindestens einmal gesehen haben sollte – ganz gleich ob Musicalhasser oder -liebhaber.