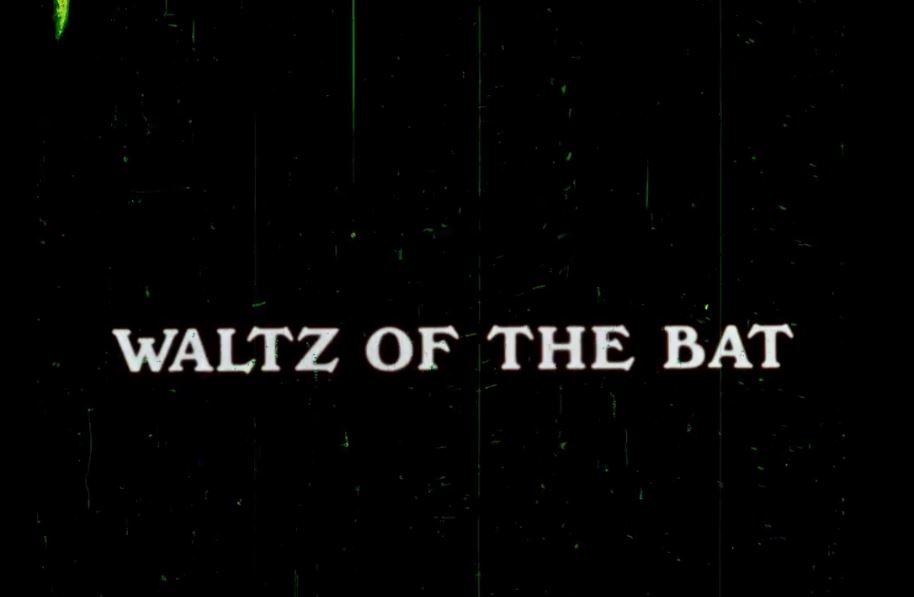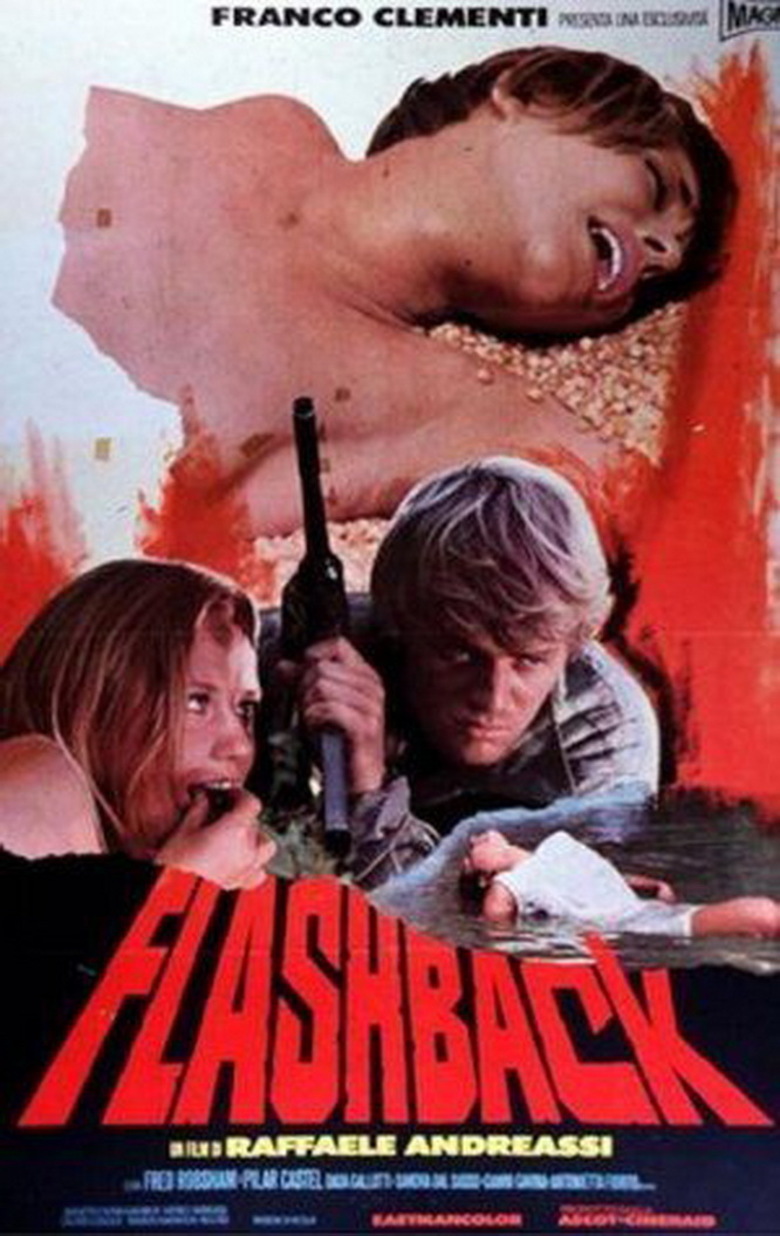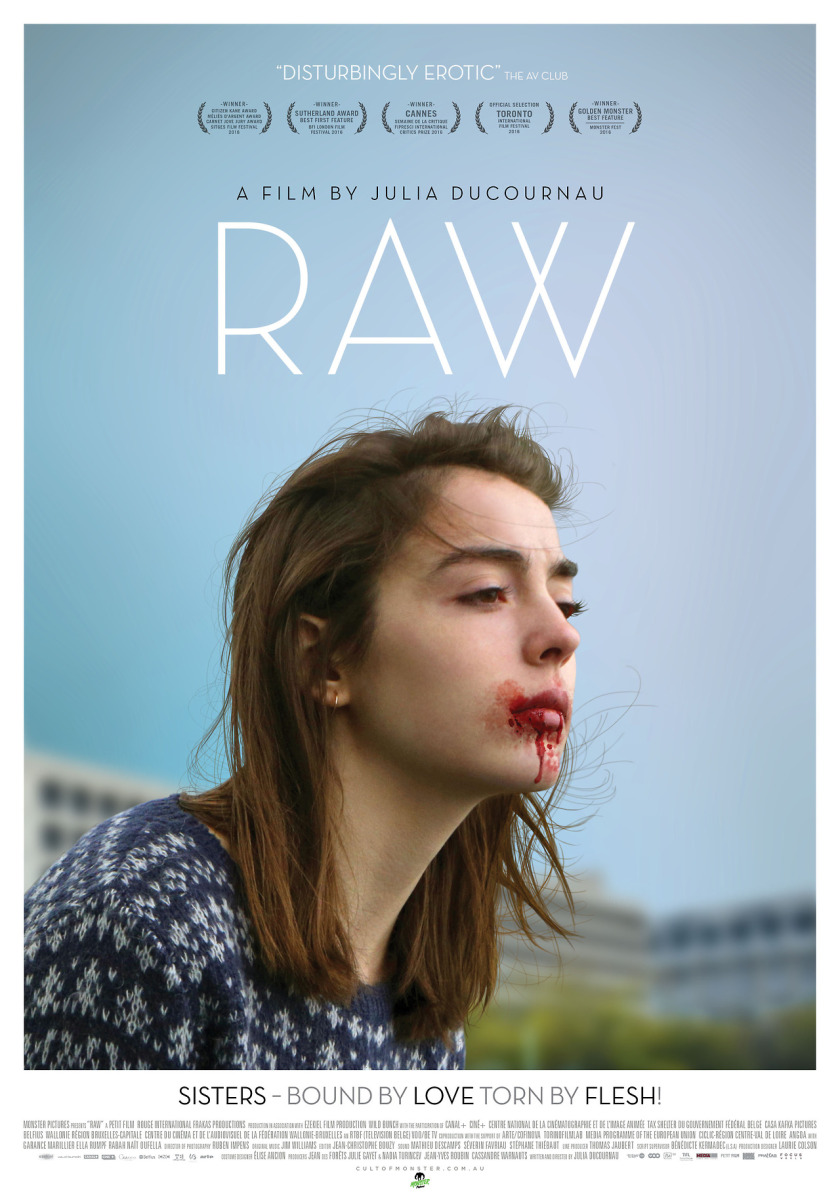Wie mancher schon weiß, habe ich mich die letzte Woche in der Altstadt von Bologna vergraben, und mich einem Vollrausch aus Filmen hingegeben, die ich natürlich allesamt nicht mit einer eigenen ausführlichen Kritik würdigen kann, weshalb nun erst einmal die Notizen folgen, die ich mir gestern, auf der sich endlos anfühlenden Zugfahrt von Hamburg nach Braunschweig, gemacht habe. Meine Augen sind wund. Die Klimaanlage hat mir eine Erkältung zugezogen. In Braunschweig regnet es schon den ganzen Tag. Ich habe das Gefühl, eine Woche kein Körper, sondern nur ein Gefühl gewesen zu sein.
Domenica 25 Giugno
L’Assedio Dell’Alcazar (Augusto Genina, Italien 1940), 112‘
Mit dem Coppa Mussolini prämierter Film über die Belagerung des Alcazar-Forts in Toldero während des Spanischen Bürgerkiegs. Dass sich die faschistische Ideologie diesem Wek eingemeißelt hat wie in Stein, darüber täuschen auch die sowieso recht deplatziert wirkenden Liebes-Subplots nicht hinweg, und sowieso bleiben wohl vor allem die außerordentlich klaustrophobischen Kampfszenen im Gedächtnis sowie die finale Einstellung, in der siegreiche Nationalisten der Kamera den römischen Gruß entgegenwerfen.
Unter den Brücken (Helmut Käutner, Deutschland 1946), 98‘
Von Hakenkreuzfahnen oder Bombenterror ist in Käutners deutlich vom französischen Poetischen Realismus beeinflussten Film über zwei Männer, einen Schleppkahn und eine Frau, obwohl bereits 1944 abgedreht, rein gar nichts zu erspähen. Wie GROSSE FREIHEIT kehrt der Film der harten Realität den Rücken zu, und beschwört eine Welt des Friedens, der jubilierenden Natur, des ungezwungenen Geschlechterverhältnisses, die nicht nur herzallerliebst, überraschend modern, sondern stellenweise - vor allem, wenn es um Gänse geht - ungezwungen komisch ist wie was aus der frühsten Nouvelle Vague.
Prix de Beauté (Augusto Genina, Frankreich 1930), 113‘
Louise Brooks macht spaßeshalber bei einem Schönheitswettbewerb mit, wird zur Miss Europa gekürt und bekommt bald erste Angebote als Filmschauspielerin. Wenig begeistert ist ihr Liebster, der sie bald vor die bittere Entscheidung stellt, was sie fortführen möchte: Ihrer Karriere oder ihrer gemeinsamen Beziehung? Mit zunehmender Laufzeit wird das lockere, leicht an Hollywood-Romantikkomödien wie IT erinnende Treiben umso grimmiger und kulminiert dann auch in einer sprachlos machenden Szene, die das Verhältnis von Tod und Film auf den denkbar ikonischsten Punkt bringt.
River of No Return (Otto Preminger, USA 1954), 91‘
Robert Mitchum, Marilyn Monroe und ein kleiner Junge fahren auf einem Floss den Fluss ohne Wiederkehr hinab – und erleben trotz Stromschnellen, auf dem Kriegspfad dahinrasender Indianer und bewaffneter Strauchdiebe das Finale natürlich trotzdem als neugeborene Heilige Familie. Das Beste hierbei sind noch der Titelsong, und die Augenweiden in Form der Cinemascope-Panoramaaufnahmen in Technicolor-Farben zum Dahinschmelzen, ansonsten konnte ich mit Premingers kitschig-süßlicher Interpretation des Western-Genre so wenig anfangen wie Monroes Make-Up mit der Idee, doch einmal wenigstens in Extremsituationen ein kleines bisschen zu verwischen.
Lunedí 26 Giugno
Bestia (Aleksander Hertz, Polen 1917), 67‘
Pola Negri verlässt ihr Elternhaus in der polnischen Provinz, um Tänzerin zu werden – und, natürlich, bringt sie dadurch Unheil über einen verheirateten Mann, der bereit ist, für die rassige Schönheit Frau und Kind zu verlassen. Einer von Negris ersten, noch in Polen realisierten Filme, der sich zu Beginn als Warnung an die Jugend vor Irrwegen des Müßiggangs gibt, diese Agenda schnell vergisst, und kurzzeitig zum Tanzmelodram wird, um schließlich als pathetisches Ehedrama in Schnief und Seufz zu enden.
Chahar Rah-E Havades (Samuel Khachikian, Iran 1955), 112‘
Unfassbare Mischung aus Thriller und Melodram vom Iranischen Hitchcock: Ein junger Mann wird vom Brautvater in spe des Hauses verwiesen, außerdem stirbt der eigene Papa, was der Familie den Geldhahn zudreht, und ihn dazu zwingt, sein Studium zu schmeißen und einen Handwerksberuf zu ergreifen. Um seine Liebste doch noch erobern zu können, schließt er sich einer Gangsterbande an. Was konventionell klingt, ist es zu kaum einem Zeitpunkt: Egal, ob Khachikian einen Juwelierüberfall oder eine herzzerreißende Sterbeszene inszeniert, die alles und jeden erschlagenden Toneffekte, schrägen Bildkompositionen und konsequent gegen den Strich gebürstete Montage verkehren noch das Abgeschmackteste (unbeabsichtigt?) ins Subversivste.
Dos Monjes (Juan Bustillo Oro, Mexiko 1934), 79‘
Mexixan Gothic, randvoll gestopft mit Reminiszenen an die Deutsche Romantik und den (teilweise aus dieser abgeleiteten) expressionistischen Gruselfilm. Die gerne rührselige Dreiecks-Geschichte um zwei Freunde, die die gleiche Frau begehren, mit ihrer grobschlächtigen Montage und den inflationären Anschlussfehlern stört kaum, weil man sich an schauderhaften Klosterkulissen, unheimlichen Fensterszenen im Stil von Ludwig Tieck und einer expressiven Kameraabeit zum Niederknien ergötzen kann.
Young Frankenstein (Mel Brooks, USA 1974), 106‘
Trotz des zumeist flachen Humors, den Inkohärenzen innerhalb der Dramaturgie, der mit zunehmender Laufzeit zunehmend unter die Gürtellinie abgleitenden Witze kann man Mel Brooks eins zugutehalten: Er konzipiert seine Adaption des Frankenstein-Mythos gleichermaßen als Parodie wie als Hommage an die großen Vorbilder von Universal bis Hammer, und sieht dabei durch seine exzellente Schwarz-Weiß-Photographie überwältigend genug aus, dass ich mich in seine Bilder stürzen kann, ohne großartig auf die mir oftmals viel zu plumpen Scherze achten zu müssen.
Martedi 27 Giugno
La Vérité (Henri-Georges Clouzot, Frankreich 1960), 127‘
Brigitte Bardot sitzt auf der Anklagebank. Sie soll ihren Freund erschossen haben. Der folgende Prozess ergibt den folgenden Film: Zwei Stunden BB in allen erdenklichen Lebenslagen vom schnellen Quickie, zum Tränensturm bis hin zur luderhaften Aggressivität, und dabei angereichert mit hübschem Chiraroscuro, etwas plakativen Nouvelle-Vague-Referenzen und unübersehbaren dramaturgischen Längen. Sicherlich nicht Clouzots bester Film.
Bandido! (Richard Fleischer, USA 1956), 92‘
Robert Mitchum als Glücksjäger in den Wirren des Mexikanischen Bürgerkriegs auf der Suche nach Geld und Frauen. Die markigen Sprüche, die man dem unzerstörbaren Protagonisten in den Mund geschrieben hat, sind vielleicht noch das Erwähnenswerteste dieser sich in plumpen Actionszenen und vor allem langatmigen Dialogszenen verlierenden Männlichkeitszelebration ohne Sinn und Verstand.
Hana Chirinu (Tamizo Ishida, Japan 1938), 74‘
Konsequent zieht Ishida sein Konzept durch: Nahezu ausschließt spielt sein Film im Innern eines Geisha-Hauses. Ebenso ausnahmslos sind seine Darsteller einzig und allein Frauen – die männlichen Rollen nichts weiter als grölende Stimmen aus dem Off -, und von dem Krieg, der draußen tobt, bekommen wir nur vom Hörensagen durch die Figuren mit. Außerdem wiederholt sich kaum ein Shot zweimal – nicht mal in Dialogszenen. Was mathematisch-verkopft klingt, ist es vielleicht auch, gerade deshalb bietet der Film aber so gut wie überhaupt keine Angriffsfläche, anhand derer man ihn kritisieren könnte - das ist der Verdient der Konsequenz, vielleicht.
Toofan Dar Shamr-E-Ma (Samuel Khachikian, Iran 1958), 102‘
Mein persönlicher Festival-Höhepunkt, und wahrscheinlich eins von Khachikians Werken mit dem hochkonzentriertesten Trash-Anteil. Nimmermüde Soundeffekte und ein wahnwitziger Orchesterscore peitschen durch eine naive Geschichte, die sich gar nicht entscheiden will, ob sie nun primär film noir, waschechter Horror oder doch schmalzige Seifenoper sein möchte. Der derangierte, hemmungslos überzeichnete, nahezu groteske Stil triumphiert in einer Weise über jedwede Substanz, dass mein Herz und dieser Film sofort unzertrennlich miteinander verwachsen sind.
Mädchen in Unifom (Léontine Sagan, Deutschland 1931), 86‘
SUSPIRIA in Preußen: Wenig gibt es für die Insassinnen eines Mädcheninternats Anfang der 30er zu lachen – es sei denn, die Schülerinnen sind mit ihrer Göttin, der Fräulein von Bernburg, zusammen, die, im Gegensatz zu ihren verbitterten Kolleginnen, den jungen Frauen eine Freundin zu sein versucht. Als Manuela sich jedoch in ihre Lehrerin bis über beide Ohren verknallt, ist die Katastrophe unausweichlich. Möglicherweise der beste, auf jeden Fall einer der ungewöhnlichsten Spielfilme, die zur Weimarer Zeit gedreht worden sind.
L’uccello dalle piume di cristallo (Dario Argento, Italien 1970), 101’
Nervenzerfetzender, an Hitchcock geschulter Spannungsfilm über einen Rom heimsuchenden Schlächter und einen amerikanischen Journalisten, der unfreiwillig zum Zeugen einer seiner Bluttaten wird, und nun selbst um sein Leben fürchten muss. Auch wenn einige Nebenfiguren wohl eher dazu gedacht sind, plakative Komik in das Werk einzuführen: Die relevanten Szenen fühlen sich an wie Daumenschrauben, und allgemein ist der Film, was Kameraarbeit und Photographie betrifft, ein Traum. Die Projektion erfolgte in Anwesenheit des Regisseurs.
Mercoledí 28 Giugno
A Mosca Cieca (Romano Scavolini, Italien 1966), 79‘
Experimentelles Frühwerk von Scavolini: Ein Mann und sein Revolver. Die Einsamkeit und Tristesse der Großstadt. Bretons Diktum, die surrealistische aller Taten sei es, einfach eine Waffe zu nehmen und mitten in eine Menge zu feuern. Was auch immer nun der genaue philosophische, politische oder gar mathematische Hintergrund sein soll, auf jeden Fall ist dieses Werk nicht zum leichtfertigen Konsum gedacht. Die Projektion erfolgte in Anwesenheit des Regisseurs.
Kino Kieta Okoto (Masahiro Makino, Japan 1941), 89’
Agatha Christie trifft auf japanisches Volkstheater. In einem kleinen Dorf irgendeines früheren Jahrhunderts wird der örtliche Geldleiher ermordet. Das Problem, das sich dem aus der Stadt angereisten Detektiv stellt: So ziemlich jeder hat irgendein Motiv, dem Geizhals an den Kragen zu wollen. Sehr statisches, inhaltlich wie formal sehr schlicht gestricktes Lustspiel, das nichtsdestotrotz oder gerade deswegen angenehm unterhält, und mit einer so realitätsfernen Pointe aufwartet, dass es schon wieder Spaß bereitet.
Zarbat (Samuel Khachikian, Iran 1964), 95’
Khachikian die Dritte. Zurückhaltender, sortierterer als seine beiden früheren Filme – doch was soll das heißen bei einem Regisseur, der es mühelos schafft, innerhalb von einer halben Minute aus einer Arztromanze einen mobiden Thriller zu machen und damit verliebte Wartezimmerblicke von keuschen Patienten einzutauschen in die verzerrten Fratzen, die ein Familienvater schneidet, als er die Leiche seines versehentlich zu Tode gebrachten Kollegen zu beseitigen versucht.
El Rebozo de Soledad (Roberto Gavaldón, Mexiko 1952), 114’
Einen Arzt verschlägt es ins mexikanische Hinterland, wo er sich zunächst mit dem Aberglauben der bäuerlichen Bevölkerung herumschlägt und sich sodann, im zweiten Schritt, in seine Haushälterin verliebt. Als die von einem Halunken vergewaltigt und geschwängert wird, kennt sein Großmut so wenige Grenzen, dass er sein persönliches Lebensglück opfert, um eine Bluttat zu verhindern. Ohne größere Höhen und Tiefen erzählt der Film seine Geschichte, und stößt sich dabei nirgendwo, kann aber selbst auch nicht wirklich nennenswerte Stöße an seine Umwelt verteilen.
Eraserhead (David Lynch, USA 1977), 89’
Henry Spencer zwischen hämisch gackernden und schrill kreischenden Monster-Babys, pausbäckigen Frauen, die in Heizkörpern leben und singen, und Fabriken, die sich zur Herstellung von Bleistiftradiergummis menschlicher Gehirne bedienen. Wahlweise unglaublich bedrückender oder unglaublich erheiternder Ausflug in öde Industrielandschaften, düstere Schwarz-Weiß-Ästhetik und ohrenbetäubende Soundcollagen, der mir in der restaurierten Fassung derart glattpoliert daherkam, dass es mir schwerfiel, den Klassiker meiner Jugend darin wiederzuerkennen, und zu der Weisheit führen: Manche Filme müssen einfach räudig aussehen, um ihre Wirkung vollends zu entfalten.
Giovedì 29 Giugno
Lucía (Humberto Solás, Kuba 1968), 160’
Drei Epochen, drei Episoden, die gleiche Frau, gewissermaßen: Immer heißt sie Lucía, ob nun 1890, 1932 oder in den 1960er Jahren, und immer ist sie die Nationalallegorie Kubas, die Solás in seinem Epos über die Wirren der Geschichte über Schlachtfelder, häusliche Gewalt bis hin zu den Verheißungen Fidel Castros begleitet. Während die ersten beiden Episoden dann doch eher Kostümfilm-Terrain beackern, sticht die dritte und letzte durch einen raffinierten Humor und offensiv artikulierten Feminismus hervor.
All That Heaven Allows (Douglas Sirk, USA 1955), 89’
Die reife Witwe Jane Wyman verliebt sich in den Naturburschen Rock Hudson, ihren Gärtner, und der sich in sie, jedoch droht die zarte Bande an einem sozialen Umfeld zu zerbrechen, das demonstrative die Nase über die vermeintlich ungleiche Verbindung rümpft. Melodramenmeister Sirk spart weder mit überschäumenden Emotionen noch mit atemberaubenden Technicolor-Farben, die wie ein ständiger Kommentar der ausgesprochenen und unausgesprochenen Seelenzustände unserer Protagonisten funktionieren.
Belle de Jour (Luis Bunuel, Frankreich/Italien 1967), 100’
Catherine Devenue langweilt sich in ihrer Ehe. Also wird sie Freizeitprostituierte, und verwöhnt fortan die abwegigen Lüste ihrer Kunden in einem Privatbordell. Freilich läuft das nicht lange gut, denn dass sich Gangster Pierre Clementi in sie verguckt, hat Folgen für alle Beteiligten. Bunuels subtil eingesetzte Surrealismen sind Mitte der 60er längst derart unterschwellig geworden, dass man genau darauf achten muss, um sie überhaupt zu bemerken – und sich dann ein bitteres Lachen zu verkneifen müht.
Divine (Max Ophüls, Frankreich 1935), 74’
Harmloses Filmchen, ungefähr so spritzig wie Champagner, und derart leichtfüßig, dass es mir wohl bald aus dem Gedächtnis flattern wird: Eine junge Frau wird Tänzerin bei einem Theaterensemble, was Ophüles Gelegenheit gibt, weniger eine Geschichte zu erzählen, sondern ein Panorama mehr oder minder vergnüglicher Einblicke ins Leben hinter den Bretter, die vielleicht nicht die Welt, aber einen unterhaltsamen Abend bedeuten, zu gewährleisten. Es wird getanzt, gesungen, gefrotzelt, und dass man den Film heute noch kennt, hat wohl hauptsächlich damit zu tun, dass das Drehbuch von Colette stammt.
La Nuit Américaine (Francois Truffaut, Frankreich/Italien 1973), 115‘
Truffauts liebevoller, augenzwinkernder, nachsichtiger Blick aufs Filmemachen, die Ökonomie des Kinos, und das eigene Schaffen: Ein Regisseur – er selbst nämlich – sieht sich bei den Dreharbeiten zu einem Liebesdrama allerhand amourösen Verwicklungen am eigenen Set genauso gegenüber wie diversen Unfällen, Starallüren und Produzenteninventionen. Wie immer spielt Jean-Pierre Léaud sich selbst – und das, wie immer, überzeugend. LE MÉPRIS ist trotzdem tausendmal besser.
Venerdì 30 Giugno
Die Schwarze Loo (Max Mack, Deutschland 1917), 60’
Tänzerin Loo erfährt durch einen todeskranken Komponisten zum ersten Mal im Leben menschliche Zuneigung, und schwört ihm und sich, sein Lebenswerk nach seinem Tode weltberühmt zu machen – wobei ihr aber ihr ehrgeiziger Gatte einen Strich durch die Rechnung zu machen versucht, der das Opus kurzerhand als sein eigenes ausgeben möchte, um zu Geld und einem Professorenposten zu kommen. Kurzweiliges Stummfilmmelodram mit der heute weitgehend unbekannten, seinerzeit aber hochfrequentierten Darstellerin Maria Orska, in deren zärtliches Gestenspiel ich mich kurzerhand verliebt habe.
Lanka dahan (Dhundiraj Govind Phalke, Indien 1917), 8‘
Wie von den meisten indischen Stummfilmen zwischen 1913 und 1931 ist auch von vorliegendem Werk des Pioniers der dortigen Kinematographie nur ein knapp achtminütiges Fragment überliefert, das jedoch einen eindrucksvollen Eindruck in die mythologischen Welten gewährt, die Phalke seinerzeit ins Bewegtbild übersetzt hat, und hauptsächlich aus Aufnahmen des sich von Ast zu Ast schwingenden Affengotts Haruman besteht, dessen Darsteller eine der überzeugendsten mir bekannten Tiermasken des frühen Kinos trägt.
Furcht (Robert Wiene, Deutschland 1917), 72‘
Graf Greven bringt von einer Indienreise eine stibitzte Buddha-Statue mit, wird von dem ihm nachreisenden Tempelpriester von seinem dadurch verwirkten Leben und seinem bevorstehenden unglückseligen Ende gewarnt, und verfällt daraufhin Wahnsinn und der titelgebenden Furcht. Früher Schauerfilm von Robert Wiene, bei dem man spätere expressionistisches Beklemmnugen höchstens rudimentär erahnen kann.
Rancho Notorious (Fritz Lang, USA 1952), 85‘
Marlene Dietrich betreibt als Gangsterboss eine Spelunke, und – wie sollte es anders sein? – gerät in die Fronten zwischen Mel Ferrer und Arthur Kennedy, die beide mehrere Augen auf sie geworfen haben. Noch das Erträglichste an diesem Film ist das satte Technicolor, während mich die Pappmaché-Kulissen zum Schmunzeln, die abgehalftere Geschichte zum Gähnen und die endlosen Dialogszenen zum Wegnicken animiert haben.
L’Insoumis (Alain Cavalier, Frankreich/Italien 1964), 103‘
In Algerien wird Alain Delon in politische Machenschaften, schließlich eine Entführung verwickelt, begeht einen Mord, und flieht letztlich über Frankreich nach Brüssel. Eine Art düsteres road movie vor dem Hintergrund des Algerienkriegs, das sich nie zu sehr in seiner Schwärze verliert, aber sich ebenso auch nie allzu nahe an lichtere Gefilde heranwagt. Wie ich überrascht feststellte, ist ein Still aus diesem Film das Cover des Queen-Is-Dead-Albums der Smiths.
Popiól i Diament (Andrzej Wajda, Polen 1958), 103‘
Ein Querschnitt durch die polnische Gesellschaft, die am 8. April 1945 in einem Kleinstadthotel das Ende des Zweiten Weltkriegs begeht, sich sinnlos betrinkt, sich Sorgen um die Zukunft macht, an Idealen festzuhalten versucht, sich verliebt – und Anschläge auf den neuen Bezirkssekretär der Kommunistischen Partei plant. Eindeutigen Positionierungen entgeht Wajda gerade dadurch, dass er uns klug ein ganzes Panorama an Figuren und Thesen präsentiert, dessen Ambivalenzen die eigentliche Stärke des Films sind.
Steamboat Bill, Jr. (Charles Reisner, USA 1928), 70‘
Buster Keaton lernt als erwachsener Mann seinen Papa, einen Dampfschifffahrer, kennen, und versetzt bei dem Versuch, nun ebenfalls dieses ehrenwerte Handwerk zu erlernen, seine Umwelt in Verzweiflung und seine Zuschauer in frenetisches Gelächter. Besonders die tricktechnisch interessanten Sturmszenen, bei denen reihenweise Häuserkulissen perfekt choreographiert um Keaton herum zusammenstürzen, verdienen meinen Respekt, auch wenn sich mein persönliches Bauchhüpfen ansonsten in Grenzen hielt. Die Projektion erfolgt auf der Piazza Maggiore mit Live-Orchester-Begleitung.
Sabato 1 Luglio
Ripresse in Egipto (Italien 1911), 13‘
Ansichten ägyptischer Straßenzüge, der Gischt vor der Küste, einer christlichen Mädchenschule, die vor Ort von Missionaren geschossen worden sind. Als ob man durch eine tiefgläubige Brille in die Vergangenheit linsen würde, dann aber doch in den meisten Szenen kaum unterscheidbar von handelsüblichen view-Kompilationen oder travelogues.
I 26 Martiri del Giappone (Tomiyasu Ikeda, Japan 1931), 65‘
Nach einer wahren Begebenheit: Im Japan des sechzehnten Jahrhunderts sind fünfundzwanzig Männer und ein Knabe bereit, sich für ihre kürzlich erfolgte Konversion zum Christentum ans Kreuz schlagen zu lassen. Ebenfalls produziert von Missionaren des Franziskanerordens und primär als Werbefilm für den Katholizismus gedacht, kann einen gerade die finale Hinrichtung der verzückten Jünglinge in der richtigen Stimmung durchaus ergreifen.
Namakura gatana (Kouchi Junichi, Japan 1917), 2‘
Früher japanischer Animationsfilm über einen Samurai, bei dem es mit dem Schwertkampf nicht ganz so läuft wie er sich das vorstellt. Die Kinder werden sich die Bäuchlein gehalten haben, und wenn die Hauptfigur in Sprechblasen-Flüche ausbricht, erweckt das einen ungemein modernen Eindruck.
Tepeyac (Carlos E. González, José Manuel Ramos, Fernando Sáyago, Mexiko 1917), 63‘
Christlicher Erbauungsfilm, der zur Rekrutierung der mexikanischen Landbevölkerung zum Heiland die Legende der Maria von Guadelupe instrumentalisiert. Diese erscheint im sechzehnten Jahrhundert einem unbedarften Indio, um ihm den Auftrag zu erteilen, an der Stelle ihrer Materialisation eine Kirche zu errichten. Natürlich glaubt die Amtskirche ihrem Gesandten kein Wort bis das erste Wunder geschieht. Strukturell wegen der den Ersten Weltkrieg als Folie verwendeten Rahmenhandlung interessantes und aufgrund der Darstellung der Gottesmutter als mit Lichtblitzen gespicktes Igelchen possierliches Filmchen für fromme Sonntagsstunden.
The Sinking of the Lusitania (Winsor McCay, US 1918), 10‘
Zwei Jahre hat Animationsfilm-Pionier Winson McCay an seinen Version des Untergangs des Passagierdampfers Lusitania, verursacht durch einen deutschen U-Boot-Torpedor 1915, gewerkelt, und so beeindruckend die animierten Szenen auch sein mögen, die weltkriegsbedingte, außerordentlich platte und verhetzte Anti-Deutsche-Propaganda macht den Kurzfilm aus heutiger Sicht mehr un- als erträglich.
Sengoku Guntoden (Eisuke Takizawa, Japan 1937), 101’
Banditenfilm, angesiedelt im japanischen Mittelalter, über Machtmissbrauch, Verrat, Rache und alle sonstige Dinge, in die sich Männer mit Waffen, die ihre Ehre über alles stellen, sonst noch so verwickeln können. Manche glorreiche Außenaufnahmen - beispielweise ein Fackelzug durch einen nächtlichen Wald – konnte auch nicht dagegen ankämpfen, dass ich schnell das Interesse an dem etwas monotonen Säbelrasseln verloren habe.
Maclovia (Emilio Fernández, Mexiko 1948), 105’
Das Traumpaar des mexikanischen Melodrams, María Félix und Pedro Armendáriz, als Bewohner einer Insel vor der zentralamerikanischen Festlandküste zwischen Anforderungen von Tradition und einer Liebe, die über gesellschaftliche Konventionen hinwegstürmen möchte. Gerade in der ersten Hälfte dann doch eher hausbacken, entwickelt sich das Werk zum Schluss hin doch noch zu einem ordentlichen Kuchen, in dessen Teig Regisseur Fernández Macht- und Hegemonie-Tendenzen innerhalb einer Vierer-Konstellation aus zwei Männern und zwei Frauen mit ganz zartem exploitativem Anhauch durchexerziert.
Saturday Night Fever (John Badham, USA 1977), 122‘
Es gibt ja schon mal Filme oder Themen, mit denen ich nichts anfangen kann – und vorliegendes Beispiel ist eins der Parade dafür. Statt dass SATURDAY NIGHT FEVER das Phänomen Disco in all seinen geschlechter-, rasse- und ständetranszendierenden Implikationen beleuchtet, erzählt er ein prototypisches Jugenddrama, bei dem die überlangen Tanzszenen zum nach ökonomischen Erwägungen schmeckenden Zugeständnis an einen Zeitgeist geraten, mit dem ich mich beim besten Willen nicht zu identifizieren weiß.