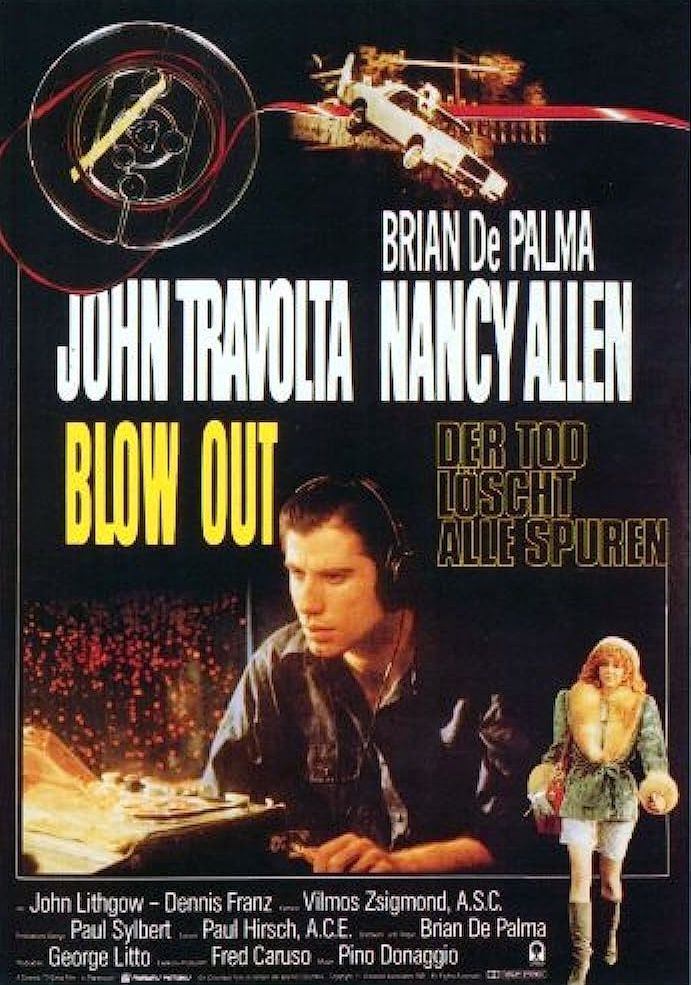Sharknado
Katastrophen-Stimmung in Los Angeles: Ein heftiges Unwetter zieht über die kalifornische Küstenstadt hinweg und mit dem steigenden Wasser und den Flutwellen kommen auch tausende Haie, die die Bewohner aus allen Richtungen attackieren. Zuerst am Strand, danach in Häusern, durch Gulli-Deckel oder auch Swimming-Pools. Strandbarbesitzer Fin Shepard (Ian Ziering "Beverly Hills 90210"), Dauergast George (John Heard), sein bester Freund Baz Hogan (Jaason Simmons) und die Kellnerin Nova (Cassie Scerbo) gelingt die Flucht in das höher gelegene Zentrum von L.A. , wo Fin´s Ex-Frau April (Tara Reid) mit den beiden Kindern lebt. Das Trio wird noch eingepackt, bevor es in höhere Gefilde geht. Doch der Wasserpegel steigt weiter dramatisch an und aus dem Unwetter entsteht ein Tornado, der sämtliche Haie mitreißt und durch die Luft wirbelt. Die kleine Gruppe patriotischer Amerikaner zieht schwer bewaffnet mit Pump Guns, Kettensägen und Bomben in den Kampf, um den gefräßigen Viechern den Garaus zu machen...
„Mörderische maritime Monster-Mutationen“ (Oliver Kalkofe)
Die US-Filmproduktion „Asylum“ hat sich ihren berüchtigten Namen mit sog.
Mockbustern gemacht; Filmen, die sich an erfolgreiche
Blockbuster-Produktionen heranhängen und mit billigen,
trashigen Plagiaten, Pseudo-Fortsetzungen etc. Kasse machen sollen. Der US-TV-Sender SyFy gibt gern TV-Produktionen in Auftrag, so auch 2013 den
Fishploitater „Sharknado“, den „Asylum“ von Anthony C. Ferrante („Scream & Run“) drehen ließ. Die Idee eines Hai-Tornados erschien so gleichsam abwegig wie neugierig machend und die filmische Umsetzung geriet so dermaßen daneben, dass sich „Sharknado“ zu einem vielkolportierten viralen Phänomen entwickelte, zum inhaltlichen Gegenstand vieler
Tweets und anderer sozialer Online-Mechanismen und sogar den Sprung ins Kino
nach seiner TV-Ausstrahlung schaffte – „Asylum“ schien endgültig im
Mainstream angelangt zu sein.
„Diese Haie haben wirklich keine Manieren!“ – „Manieren? Ich dachte, du wärst Australier und kein Engländer!“
Ein Jahrhundertunwetter bedroht Los Angeles. Als es ausbricht, schwemmt es Hunderte von Haien ans Land, die in der überfluteten Stadt die Menschen bedrohen. Fin Shepard (Ian Ziering, „Beverly Hills 90210“), Betreiber einer Strandbar, sein Dauergast George (John Heard, „C.H.U.D. - Panik in Manhattan“), sein bester Freund Baz Hogan (Jaason Simmons, „Baywatch“) sowie seine Kellnerin Nova (Cassie Scerbo, „Teen Spirit“) fliehen ins etwas höher gelegene Gebiet und holen dort Fins Ex-Frau April (Tara Reid, „The Big Lebowski“) mit beiden Kindern ab. Doch an Sicherheit ist nicht zu denken, denn das Wasser steigt und steigt und schließlich entsteht ein Wirbelwind, der die Haie mitreißt und über der Stadt niederregnen lässt...
„Hat dir 'n Känguru ins Gehirn gepullert?“
Fishploitation und kein Ende – mutmaßlich mit Alexandre Ajas „Piranhas“-Remake losgetreten, erfreut sich das seinerzeit von Steven Spielberg mit „Der weiße Hai“ begründete Subgenre wieder ungebrochener Beliebtheit, vornehmlich mit Haien in allen Variationen. „Sharknado“ steht dabei stellvertretend für immer absurder werdende Ideen à la „Sand Sharks“ oder „Two-Headed Shark Attack“, die aus ihrem zu erwartenden
Trash-Gehalt kein Geheimnis machen und die Neugierde der potentiellen Zuschauer wecken sollen. „Asylum“-Produktionen scheinen mir dabei ein Konzept zu verfolgen, die Filme durchaus scheinbar ernsthaft zu inszenieren und damit hinterm Berg zu halten, dass man sich des Unfugs, den man da treibt, vollends bewusst ist, statt alles unzweideutig ironisch zu brechen, komödiantisch zu überzeichnen und plakativ mit dem
Trash-Banner zu wedeln. Dabei könnten also durchaus krude Kracher in berüchtigter
Exploitation-Manier herauskommen, sollte man meinen – nicht jedoch in diesem Falle.
Das liegt vor allem daran, dass sich auch „Sharknado“ zwar einen ernsten Anstrich gibt, leider gelegentlich unterbrochen von US-Hollywood-Kino-typischen pseudowitzigen Sprüchen, man sich aber kaum Mühe gab, einen über seine absurde Grundidee hinausgehenden Film zu realisieren. Man verlässt sich ausschließlich auf die Sogwirkung des Namens, dem man zwar im Finale halbwegs gerecht wird, vernachlässigt aber fast alles andere – zugegeben: außer der Besetzung. „Asylum“-typisch gelang es einmal wieder, für anscheinend nicht allzu viel Geld echte Schauspieler zusammenzutrommeln, die sich nicht zu schade sind, mit ernster Miene gegen CGI-Fische zu kämpfen – die
Hai Society sozusagen. Ex-„Beverly Hills 90210“-Lockenkopf Ian Ziering ist mit einem überraschenden Enthusiasmus bei der Sache, Simmons dank „Baywatch“ bereits küstenerfahren, John Heard schnell weg vom Fenster und Tara Reid 'ne Perle vor die Haie. Ansonsten sieht's eher düster aus: Erzählerisch ist „Sharknado“ arg misslungen. Der gesamte Prolog erweist sich als praktisch komplett redundant für den Film. Mit unsympathischen Charakteren soll man mitfiebern. Ein krampfhaft eingeflochtenes Beziehungsdrama interessiert nicht die Bohne, schindet aber Spielzeit. Gnadenlos uninteressante und langweilige Streckszenen voll Familiendramasülze ziehen sich ab einem gewissen Punkt durch den gesamten Film. Empathie zu den Charakteren entwickelt sich so nicht, stattdessen wünscht sich ihr schnelles Ableben, damit sie endlich die Klappe halten. Damit stochert „Sharknado“ vielmehr im abgestandenen Katastrophenfilm-Sumpf bzw. darin, was dort gerne falsch gemacht wurde, statt grätenharten Tierhorror feilzubieten.
Zudem sieht „Sharknado“ total künstlich aus: Die computergenerierten Spezialeffekte scheinen heutzutage derart kostengünstig zu bekommen zu sein, dass ein Großteil des Spektakels computeranimiert wurde – und das einfach schlecht und unter dem Niveau heutiger Computerspiele. Doch nicht nur die Hai-Attacken stammen aus der Konserve, offensichtlich auch das Wetter und was es mit sich bringt. Weshalb Wetter und Helligkeit dann von Bild zu Bild schwanken, muss man ebenso fragen dürfen wie nach dem starren Wolkenpanorama trotz angeblich starken Sturms. Vieles ist dem grottenschlechten Schnitt zuzuschreiben, der aus „Sharknado“ einen hektischen, sprunghaften, zusammenhanglosen Film macht, der wirkt wie ein zappelnder Fisch auf dem Trockenen statt wie ein furchterregendes Raubtier im Haifischbecken der Filmindustrie. Na gut, wenigstens die Riesenradszene ist meines Erachtens ganz gut gelungen, sie ist zumindest actionreich und nicht allzu mies gemacht.
Auf seine magere Punkteausbeute kommt der weitestgehend zahnlose „Sharknado“ durch seine Ideen, für die die meisten Gesetze der Biologie und Physik kurzerhand gebrochen werden: Da wuseln Flachwasserhaie durch die Straßen, andere beißen Autos auf wie Fischkonserven, springen durch Fenster oder klettern Seile hoch (!). Auf den titelgebenden Wirbelsturm muss man lange warten, im Finale ist's dann aber
endlich soweit und mit ihm hält sogar etwas
Gesplatter Einzug. Der absolute Höhepunkt ist die Kettensägenszene, die die eigentliche Pointe des Films darstellt und für manches entschädigt. Auf die von mir sehnsüchtig erwartete Szene einer Windhose voller Haie, die über Menschen hinwegfegt und lediglich abgenagte Skelette zurücklässt, musste ich aber leider verzichten (evtl. eine Idee für „Piranhanado“?).
All das kann natürlich ebenso wenig ernstgemeint gewesen sein wie die Spitzenidee, Bomben in einen Wirbelsturm zu werfen, ein Auto detonieren zu lassen, nur weil Benzin ausläuft und mit einem explodierenden Swimmingpool (!) noch einen draufzusetzen. Nicht unerwähnt bleiben darf auch die symbolschwangere Szene, die den Hollywood-Schriftzug auf den Hügeln demontiert. Insofern hat „Sharknado“ also durchaus ein gewisses Unterhaltungspotential, das jedoch über weite Strecken einfach nicht zünden will in einem größtenteils anorganisch wirkenden Film, der zur Hälfte aus dem Computer kommt und allein schon deshalb zu keinem Zeitpunkt den Charme gern auch
trashiger Monster- und sonstiger Horrorfilme der sensationslüsternen
Low-Budget-Sorte atmet. Mit seinen technischen und inszenatorischen Unzulänglichkeiten mag er einmalig unfreiwillige Komik zu entwickeln, eigentlich ist er aber ärgerlich dahingeschludert worden und schafft es nicht, den Zuschauer zu fesseln, der sich zwischen den o.g. Ideen vornehmlich langweilt. Regisseur Ferrante sollte evtl. besser seine Musikkarriere weiterverfolgen, immerhin stammt der Rock-Soundtrack zu Beginn des Films anscheinend von seiner eigenen Band. „Asylum“ indes darf sich ob des in dieser Form sicherlich unerwarteten Erfolgs die Hände reiben und das popkulturelle Trendpublikum solange melken, bis es sich entnervt dem nächsten kurzweiligen Phänomen widmet.