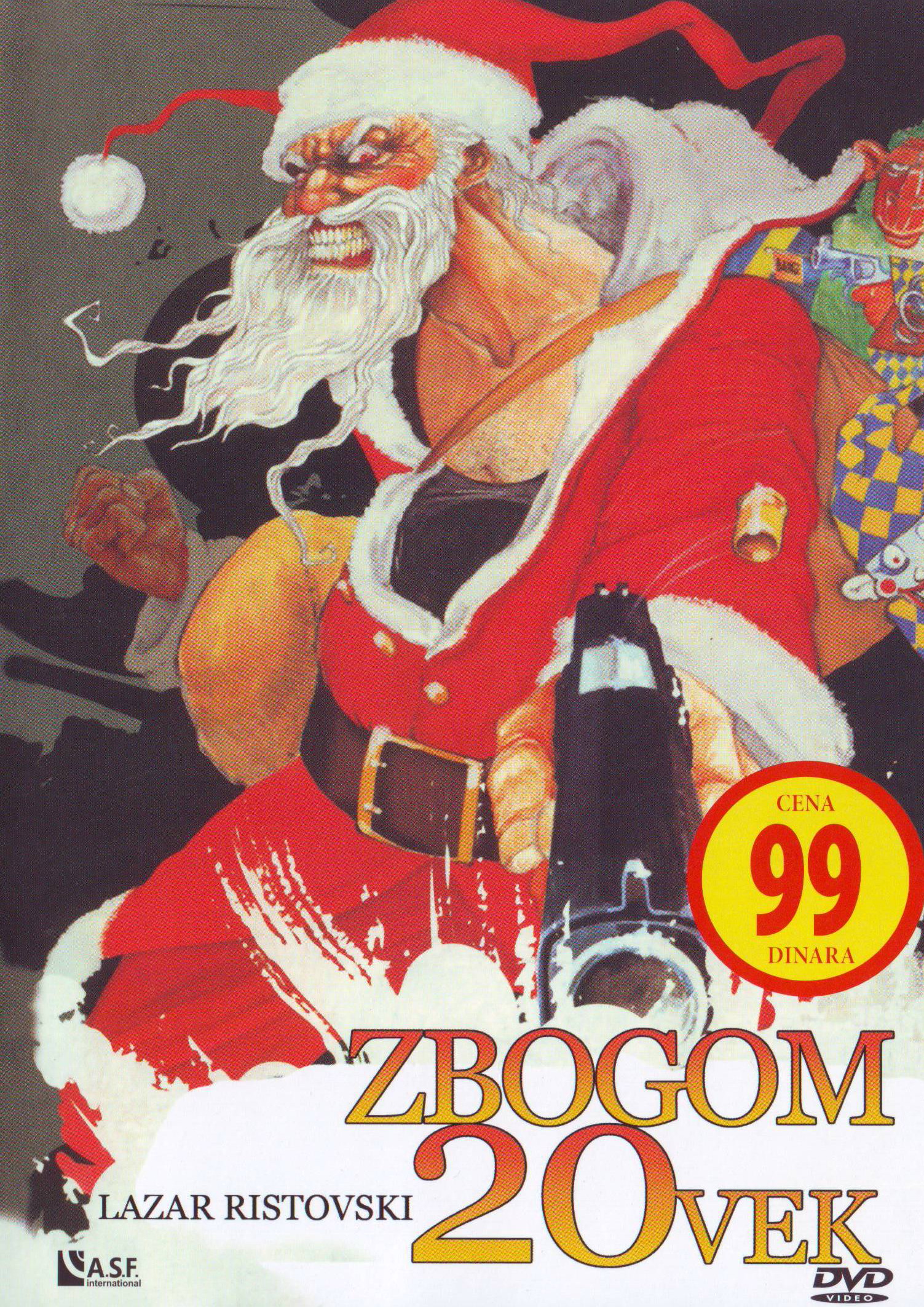Dass der Sinn der Bevölkerung in einem solchen Klima, wo der Verfall jeglicher Ordnung wie ein Damoklesschwert drohend über der mühsam erlangten Stabilisierung der gesellschaftlichen Lage schwebt, nicht nach einem Kino steht, das seine Finger in die offenen Wunde der zurückliegenden Jahre voller Militärgewalt, Verrat, Meuchelmord und Bruderkämpfen gräbt, dürfte klar sein. In seinem Goldenen Zeitalter von den frühen 30ern bis in die 50er Jahre wird Mexiko international, wenn man mal von den subversiven Eskapaden eines Luis Bunuel wie vor allem LOS OLVIDADOS (1950) einmal absieht, für seine Melodramen bekannt, in denen Stars wie die Diven Mariá Félix und Dolores del Río, der singende Cowboy Eulalio González oder gestandene Mannsbilder wie Pedro Armendáriz hauptsächlich in zeitlose Liebesgeflechte verstrickt werden. In diesen Filmen dienen die ökonomischen, gesellschaftskritischen, sozialpolitischen Kommentare – wie beispielweise in den kürzlich von mir auf dem Cinema Ritrovato begutachteten EL REBOZO DE SOLEDAD (Roberto Gavaldón, 1952) oder MACLOVIA (Emilio Fernández, 1948) – meist als bloße Hintergrundfolie, vor denen sich die üblichen Konstellationen von verbotenen Beziehungen, folgenschweren Verwechslungen und Selbstopferung in recht schematischer, d.h. Hollywood-konformer Weise abspielen.
Schon zu Beginn der Mexikanischen Tonfilmzeit hat allerdings bereits Fernando de Fuentes (1894-1958), seines Zeichens studierter Philosoph, Journalist und zeitweilige linke Hand des Revolutionsführers Venustiano Carranza, den Versuch unternommen, in seiner sogenannten TRILOGÍA DE LA REVOLUCIÓN sowohl von eher rührseligen Schmachtfetzen Abstand zu nehmen als auch davon, die zurückliegenden Bürgerkriegsjahre in irgendeiner Weise zu glorifizieren oder auch nur zu romantisieren. Vom zeitgenössischen Publikum geschmäht und vom Ausland gleich gar nicht zur Kenntnis genommen, erfuhren seine drei zwischen 1933 und 1936 gedrehten, und nicht personell oder handlungstechnisch, sondern allein durch Fuentes Haltung gegenüber der ontologisch fassbaren Wirklichkeit miteinander verbundenen Filme erst ab den 60er Jahren ihre Aufwertung als Meilensteine eines Kinos, das es weniger kümmert, was die Außenwelt von ihm an Traumbildern fordert, sondern dem es um die Darstellung einer – wie auch immer gearteten und definierten – „Wahrheit“ geht. Im Folgenden möchte ich auf sämtliche Bestandteile der Trilogie – EL PRISIONERO TRECE (1933), EL COMPADRE MENDOZA (1934) sowie VÁMONOS CON PANCHO VILLA! – relativ kurze kritische Schlaglichter werfen, und vor allem herausstreichen, was für ästhetische, formale und narrative Methodiken es sind, die sie als Dreiergespann zusammenhalten.
EL PRISIONERO TRECE

Produktionsland: Mexiko 1933
Regie: Fernando de Fuentes
Drehbuch: Fernando de Fuentes, Manuel Ruiz
Darsteller: Alfredo del Diestro, Luis G. Barreiro, Adela Sequeyro, Arturo Campoamor, Adela Jaloma
Julián Carrasco ist wohl einer der heftigsten Schluckspechte der Filmgeschichte: Gleich im Prolog von EL PRISIONERO TRECE lernen wir den Colonel von seiner unliebsamsten Seite kennen. Beim Kartenspiel mit einem Zechbruder hat er derart zügellos zur Flasche gegriffen, dass er kaum noch die Karten in seinen Händen erkennt. Anschließend poltert er wegen einer Nichtigkeit gegen seine Ehefrau, Marta, und ihren gemeinsamen kleinen Sohn Juan los, und droht sogar, von seiner Schusswaffe Gebrauch zu machen. Marta wiederum hat endgültig die Nase gestrichen voll von den Exzessen ihres Angetrauten, packt in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ihre wichtigsten Halbseligkeiten, und verschwindet mit dem Knaben auf Nimmerwiedersehen. Jahre verstreichen, wir schreiben Ende 1914, offiziell an der Regierungsmacht befindet sich General Victariano Huerta, dem Carrasco als beflissener Handlanger gerne dabei behilflich ist, Mexiko von Oppositionellen zu säubern. Ohne jemals wieder Kontakt mit dem Vater gehabt zu haben, ist inzwischen auch Juan zu einem jungen Erwachsenen herangereift, hat bereits eine Freundin namens Gloria, und wohnt zusammen mit Marta in einer Wohnung gar nicht allzu weit entfernt von dem Regierungsgebäude, wo Carrasco noch immer eifrig dem Schnaps zuspricht und seine Macht ebenso eifrig für den eigenen Vorteil nutzt. Eine seiner liebsten Einnahmequellen stellen Geldspenden von Familien dar, die ihre Söhne vor der anstehenden Hinrichtung loskaufen wollen, und als Mutter und Schwester des inhaftierten José Ramos, der im Morgengrauen den Körper voller Blei bekommen soll, bei ihm um Begnadigung von Sohn und Bruder bitten, sieht er darin ein besonders lukratives Geschäft. In ihrer Notsituation sind die Ramos gleich bereit, Carrasco und seinen Helfershelfern ihren gesamten Grundbesitz abzutreten, und da der Colonel selbst im Vollrausch noch sein Wort hält, wird der Verurteilte noch am gleichen Abend in die Freiheit entlassen. Problem ist nur: Damit dem Erschießungskommando am nächsten Morgen nicht das Fehlen eines Delinquenten auffällt, muss Ersatz gefunden werden. Carrasco schickt also einen seiner Untergebenen in die nächtlichen Straßen von Mexiko City mit dem Auftrag, irgendjemanden aufzugreifen, der entfernte Ähnlichkeit mit José Ramos hat, und an seiner Stelle aufs Schafott geführt werden kann – egal, um wen es sich dabei handle. Wie es der Zufall und das perfide Drehbuch will, ist es ausgerechnet Carrascos eigener Sohn auf dem Weg zu seiner Liebsten, der den Häschern ins Netz geht…
EL PRISIONERO TRECE ist der wohl grobschlächtigste, krudeste, schwärzeste Film aus Fuentes Revolutionstrilogie. Das liegt nicht nur daran, dass er technisch noch sehr in den Fußstapfen der Stummfilmzeit steht, von der sich Mexiko erst kurz zuvor verabschiedet hat, sondern vor allem an der reichlich unsentimentalen Geschichte: In EL PRISIONERO TRECE gibt es, was auch für die beiden Folgefilme gelten wird, keine wirkliche Identifikationsfiguren, sondern einzig Menschen, die vom Schicksal in bestimmte Situationen geführt werden, und dort entweder – wie Juan oder Marta – nichts weitertun können als sich ohnmächtig zu fügen, oder aber – wie Carrasco – nach dem schlechtesten Anteil ihres Gewissens zu handeln. Dass der Colonel als ein Scheusal vor dem Herrn gezeichnet wird, das, wenn es seinem eigenen Vorteil dient, noch die eigene Mutter an den Teufel verschachern würde, und die ihm unterstellten Militärs entweder als mindestens genauso gierige Selbstbereicherungsmaschinen oder als kritiklos noch jeden Befehl hinnehmende Ausführungsorgane ohne humane Züge, macht es genauso unmöglich, in deren Reihen irgendeinen Sympathieträger oder gar Helden ausfindig zu machen, wie auf der entgegengesetzten Seite: Wenn sich die Gelegenheit ergibt, ist José gerne bereit, seine Kameraden im Stich zu lassen und zusammen mit Mama und Schwester in sein vorheriges aristokratisches Leben zurückzukehren, was ein ähnlich ernüchterndes Licht auf die angeblich hehren Ideale der Revolutionäre wirft wie die Tatsache, dass die meisten von ihnen, angesichts der auf sie gerichteten Exekutionsgewehrmündungen, deren tödliche Blicke nicht, wie sie angekündigt haben, stolz erwidern, sondern (verständlicherweise) in Todesangst vor ihnen ins Schlottern geraten. Selbst Juan, der als personifiziertes Opfer der Umstände noch am ehesten zur Identifikation hätte einladen können, wirkt wie ein verschüchtertes Bübchen, das von dem über ihm zusammenstürzenden Ereignissen heillos überfordert ist, und ständig am Heulkrampf entlanglaviert.
Während all diese Punkte es wahrscheinlich gewesen sind, die dem zeitgenössischen Publikum als viel zu dicht an der erlebten Wirklichkeit der Bürgerkriegsjahre aufstießen, kann ich den Film aus heutiger Sicht nur für seine Kompromisslosigkeit begrüßen: Die Montage mag zuweilen holprig und nicht frei von Anschlussfehlern sein, teilweise hat der Film, was seine Kameraarbeit betrifft, etwas allzu Statisches, und dass für die meisten Nebendarsteller Laien komplett ohne Schauspielerfahrung verpflichtet worden sind, sieht man mancher Szene überdeutlich an – obwohl das natürlich, wie man weiß, alles keine Argumente sind, die mich einen Film nicht frenetisch lieben lassen, im Gegenteil. Aber all diese vermeintlichen Defizite unterstützen die erbarmungslose, parabelhafte, von hervorragenden Hauptdarstellern getragene Story, wie ich finde, noch zusätzlich derart, dass EL PRISIONERO TRECE zugleich den ungeschliffensten, für mich persönlich aber auch den eindrucksvollsten, weil erschütterndsten Film aus Fuentes Revolutionstrilogie darstellt. Einen Wehmutstropfen gibt es indes: Da die zeitgenössische Filmzensur sich überhaupt nicht mit dem Gedanken anfreunden konnte, ein Werk auf die Leinwände zu lassen, in dem ein Vater verantwortlich am Tod des eigenen Sohns ist, musste Fuentes auf ein nicht nur versöhnliches, sondern schlicht bescheuertes Alternativende ausweichen: Dort erwacht Carrasco, nachdem gerade die Gewehre auf Juan angelegt worden sind, am Spieltisch der Eröffnungsszene aus einem alkoholinduzierten Fiebertraum, begreift, dass die komplette Filmhandlung ihm einzig und allein der böse Geist des Rums vorgegaukelt hat, und schwört, fortan nie wieder einen Tropfen von dem Teufelszeug anzurühren, und sich stattdessen vorbildlich um Frau und Kind zu kümmern. Wie sehr mit der heißen Nadel gestrickt dieses Happy End dem Film seinerzeit aufgepfropft worden ist, zeigt allein folgende Überlegung: Wenn, wovon auszugehen ist, da der kleine Juan im Jahre 1914 bereits die Pubertät hinter sich hat, zu Beginn aber erst schätzungsweise fünf oder sechs Jahre alt ist, die Anfangsszene von EL PRISIONERO TRECE irgendwann um die Jahrhundertwende spielt, muss Carrasco wahrhaft prophetische Gaben besitzen – denn wie sonst hätte er in seinem Alkoholdelirium voraussehen können, dass über eine Dekade später in Mexiko ein Bürgerkrieg toben und General Huerta kurzzeitig das Amt des Staatsoberhaupt bekleiden wird?
EL COMPADRE MENDOZA

Produktionsland: Mexiko 1934
Regie: Fernando de Fuentes
Drehbuch: Juan Bustillo Oro
Darsteller: Alfredo del Diestro, Carmen Guerrero Franco, Antonio R. Frausto, Luis G. Barreiro
Während der Revolutionsjahre ist Rosalío Mendoza wie das sprichwörtliche Fähnchen im Wind, vielleicht auch wie ein Chamäleon, das die Farbe seiner Haut nach derjenigen der Umfelde ausrichtet, in die es versetzt wird: Seine Hacienda steht prinzipiell jedem offen, der dort Einlass gewährt. Wenn es Zapatisten zu ihm verschlägt, lässt er seinen Haushälter Atenógenes das gerahmte Bildnis des Generals Huerta in seinem Arbeitszimmer durch ein Gemälde Emiliano Zapatas ersetzen, und wenn Regierungstreppen bei ihm rasten, hat sich das Gesicht an der prominenten Wandstelle auf wundersame Weise in die entgegengesetzte Richtung verwandelt. Eine Weile fährt Mendoza mit dieser Taktik prächtig, und auch sonst läuft es im Leben des gutsituierten Großgrundbesitzers nicht schlecht: Mit Dolores findet er letztlich sogar eine ungleich jüngere Frau, die ihn nicht unbedingt liebt, aber respektiert, und die bereit ist, mit ihm das Band der Ehe zu knüpfen, um in den unsicheren Zeiten eine gesicherte Existenz und ein Dach über dem Kopf zu erhalten. Auf der Hochzeitsfeierlichkeit knallen indes nicht nur die Korken: Da auf Mendozas Grund und Boden einige Zapatisten von der Mexikanischen Armee gefangengenommen worden sind, stürmen diese wiederum sein Freudenfest, und verurteilen ihn, und einige Anwesende, ihrerseits zum Tode. Nur durch das gute Zureden General Felipe Nietos, einem Cousin Zapatas höchstpersönlich, bleibt es Mendoza erspart, sein junges Eheglück gegen einen frühen Tod eintauschen zu müssen. Aus Dankbarkeit, erneut seinen Hals aus der Schlingen gezogen zu haben, bittet er Nieto, zum Patenonkel seines ungeborenen Sohns zu werden, der dann auch seinen Namen, Felipe, tragen soll. Nieto erklärt sich bereit, die Patenonkelschaft zu übernehmen, was innerhalb der Mexikanischen Kultur ein Bündnis bedeutet, das an Dicke noch das der Freundschaft übersteigt: Im Falle des Todes Mendozas wird Nieto die Vaterrolle für den kleinen Felipe einnehmen. Obwohl die Gegend zunehmend von Regierungstruppen kontrolliert wird, schafft es Nieto dennoch, seinem Freund und seinem Patenkind in den Folgejahren immer wieder heimliche Besuche abzustatten - immer unter dem Risiko, die Abstecher ins Feindesgebiet mit dem Leben zahlen zu müssen. Womit Nieto, Dolores, und vor allem der kleine Felipe, der seinen Patenonkel abgöttisch verehrt, nicht gerechnet haben: Als eine gesamte Jahresernte Mendozas mitsamt dem Zug, der sie in die Hauptstadt transportieren sollte, von den Zapatisten in Schutt und Asche gelegt worden ist, die finanzielle Situation der Familie deshalb zunehmend desolater wird, und er von Angehörigen der Mexikanischen Armee, die zeitweise bei ihm einquartiert sind und von seiner engen Verbindung zu Nieto erfahren haben, versichert bekommt, würde er dafür sorgen, dass der führende Zapatist ihnen ins Netz ginge, solle das sein Schaden nicht sein, gerät das Fähnchen Mendoza erneut unter den Einfluss eines wütend pustenden Winds…
Dass Fuentes Kino sich seit dem (im positiven Sinne) ungehobelten Vorgänger technisch und formal weiterentwickelt hat, ist bei EL COMPADRE MENDOZA nicht zu übersehen: Es gibt nun klug choreographierte Kamerafahrten, die Situation und Figuren akzentuieren, der Schnitt ist wesentlich geschmeidiger, insgesamt macht der Film einen wesentlich professionelleren Eindruck, was noch durch die - im Übrigen aus der Feder des "Vaters" des mexikanischen Horrorfilms, Juan Bustillo Oro, stammende - ungleich komplexere Handlung verstärkt wird, die in einem Zeitrahmen von etwa einem Jahrzehnt nicht nur die verschiedenen politischen Umwälzungen innerhalb des Bürgerkriegs nachzuzeichnen versucht, sondern zugleich die, erneut parabelhafte und zeitungebundene, Geschichte einer Familie, einer Freundschaft und eines Verrats erzählt – und dabei ungleich subtiler zu Werke geht als noch EL PRISIONERO TRECE. EL COMPADRE MENDOZA ist leiser, behutsamer, subtiler – dass beispielweise zwischen Dolores und Nieto offenbar mehr als eine reine freundschaftliche Beziehung besteht, veranschaulicht Fuentes allein über den einen oder anderen Blick, den die beiden einander, wenn sie sich unbeobachtet von Mendoza und uns, ihren Zuschauern, meinen, verstohlen zuwerfen: ein Understatement, das in mir sofort Assoziationen an die ähnlich unausgesprochene, und doch irgendwie spürbar in der Luft liegende Liaison zwischen Ethan Edwards und seiner Schwägerin in John Fords THE SEARCHERS wachruft -, und dabei auf keinen Fall weniger herzzerreißend.
Obwohl man das Ende lange schon voraussieht, ändert das nicht an dem Kloß im Hals, den man dann tatsächlich verspürt, wenn man die steifgewordenen Füße Nietos im Abendwind pendeln sieht, und obwohl eine Figur wie Nieto und einige der Zapatisten dann doch eher als angenehme Zeitgenossen auftreten, fällt es auch in EL COMPADRE MENDOZA schwer, eine Person ausfindig zu machen, mit der man gerne Kaffeetrinken gehen würde: Für Mendoza - erneut von dem mich unweigerlich an Heinrich George erinnernden, schlicht großartigen Alfredo Del Diestro verkörpert! - hat man im Grunde bereits relativ früh nicht viel mehr als Verachtung übrig, während seine Frau, Dolores, in ihrer gesellschaftsbedingten Unscheinbarkeit sowieso zur Handlungsunfähigkeit verdammt ist, und man sich selbst bei Nieto, wenn er, gerade frisch von einem Scharmützel kommend, im Schutz der Nacht zu seinem Patenkind schleicht, ernsthaft fragen muss, inwieweit seine Besuche bei den Mendozas nicht primär von dem Verlangen geprägt sind, Dolores um sich zu haben. Der einzige weiße Fleck in dem zutiefst korrumpierten, selbstsüchtigen, machtbesessenen Ensemble trägt, erneut, die Gestalt eines Kindes: Der kleine Felipe ist, bei seinem Alter wenig verwunderlich, nicht nur genauso naiv und blauäugig wie der ungleich ältere Juan in EL PRISIONERO TRECE, sondern begreift bis zum bitteren Ende nicht, was um ihn herum eigentlich vor sich geht. Wenn er gemeinsam mit der Mama von der Hacienda flüchtet, wo die Revolutionstruppen zum letzten Gefecht mit den Zapatisten blasen, und, als er sie weinen sieht, sie damit zu ermuntern versucht, dass der Patenonkel sie doch auch in ihrer neuen Heimat besuchen kommen könne, dann schüttet Fuentes noch eine zusätzliche Schaufel Bitterkeit in seinen Film, denn das böse Erwachsen steht dem unbedarften Buben ja erst noch bevor. Doch auch Fuentes zurückhaltend beobachtende Weise, seine Geschichte zu erzählen, trägt dazu bei, den Betrachter auf eine Distanz zu halten, die allerdings keinen Schutz bedeutet. Dreh- und Angelpunkt ist nahezu ausschließlich Mendozas Hacienda, der die Kamera interessiert, jedoch ohne Mitleid dabei zuschaut wie die Zeit über sie und ihre Bewohner hinwegfegt, und letztlich selbst für die Ewigkeit geschmiedete Bündnisse wie eine Männerfreundschaft auseinanderpflückt.
VÁMONOS CON PANCHO VILLA!

Produktionsland: Mexiko 1936
Länge: 92 Minuten
Regie: Fernando de Fuentes
Drehbuch: Fernando de Fuentes, Xavier Villaurrutia
Darsteller: Antonio R. Frausto, Domingo Soler, Manuel Tamés, Ramón Vallarino, Carlos López
Lasst uns Pancho Villa folgen! Gemeint ist natürlich nicht der philippinische, 1925 im Alter von gerade mal dreiundzwanzig Jahren verstorbene Fliegengewichtsboxer, dem Mark Kozelek einen ergreifenden Song gewidmet hat, sondern der mexikanische Revolutionär, der zwischen 1910 und 1920 ist Villa für den Norden des Landes das darstellte, was Emiliano Zapata für den Süden gewesen ist: Die Anhänger Porfirio Díaz‘ sehen in ihm einen Banditen, die Landbevölkerung und seine Waffengefährten verehren ihn noch nach seinem frühen Tod 1923 – er verstirbt, wie Zapata drei Jahre früher, an den Folgen eines Attentats – als nahezu mythische Figur, die mittels Volkslegenden Unsterblichkeit erlangt. Leben und Sterben von Zapata hat sich Hollywood bereits in den frühen 50ern angenommen, zu einem Zeitpunkt, als Mexiko unter Präsidenten wie Camacho, Valdés oder Cortines innenpolitisch und wirtschaftlich wieder auf einigermaßen stabilen Beinen steht. VIVA ZAPATA! gerät mit Marlon Brando in der Titelrolle und unter der Regie von Elia Kazan zu einem veritablen Historienfilm über die korrumpierende Kraft der Macht – und bleibt, für Hollywood-Verhältnisse, schon nahezu zurückhaltend, was Faktoren wie Pathos oder Kitsch betrifft. Bereits 1936 aber hat Mexiko selbst mit dem dritten Teil von Fuentes‘ Revolutionstrilogie eine eigene Superproduktion über die Wirren der Revolution in die Lichtspielhäuser entlassen. Erstmals steht Fuentes ein ordentliches Budget zur Verfügung, zudem stellt die Regierung der mit 1 Million Pesos bis dato teuersten Filmproduktion des Landes überhaupt ein unglaubliches Kontingent an Ressourcen zur Verfügung. Von Uniformen, Pferden, Waffen bis hin zu ganzen Regimentern ist da alles dabei, was Fuentes braucht, um sich von den vergleichsweise kammerspielartigen, zumeist in Privaträumen sich abspielenden Vorgängerfilmen zu lösen, und ein Schlachtfeldpanorama des Bürgerkriegs zu inszenieren. Freilich erzählt VÁMONOS CON PANCHO VILLA!, im Gegensatz zu VIVA ZAPATA!, dennoch viel mehr die Geschichte einiger namenloser Bauern, die dem titelgebenden Revolutionsführer auf Gedeih und Verderb folgen, und die in keinem Geschichtsbuch der Welt jemals eine Erwähnung finden werden, die über die als amorphe Masse hinausgehen würde.
Die Löwen von San Pablo nennen sich die sechs Freunde, die, als die Not der Landbevölkerung unter Díaz unerträglich wird, ihren Schwur auf Villa leisten, und gemeinsam mit seiner Guerilla-Armee gegen das Staatsmilitär losmarschieren. Don Tiburico Maya ist, aufgrund seines fortgeschrittenen Alters, Anführer der kleinen Gruppe, während Miguel Ángel del Toro, genannt „Das Kalb“, am anderen Ende der Altersskala den tatenfrohen, jedoch noch weitgehend unerfahrenen Buben gibt, den die Revolution zum Mann machen wird. Zwischen diesen beiden Pole liegt ein breites Spektrum unterschiedlichster Typen, angefangen vom etwas fettleibigem Tollpatsch, der fast immer danebenschießt, nur dann nicht, wenn es drauf ankommt, über den bärbeißigen Draufgänger, der Rum statt Wasser trinkt, bis hin zum aufopferungsvollen Tatmenschen, der sein Leben für das der Gruppe gibt. Unsere Protagonisten erleben in den neunzig Minuten, die VÁMONOS CON PANCHO VILLA! benötigt, um sein Publikum von der These zu überzeugen, dass man, geeint von einer Idee, nur im Kollektiv wirklich stark ist, wenn jeder bereit ist, seinen Kopf für seine Brüder hinzuhalten, zahlreiche Abenteuer, die aber allesamt wirken, als seien sie vollkommen dem Leben abgeschaut, d.h. Fuentes Film ist für ein Kriegsdrama der mittleren 30er so wirklichkeitsbezogen wie man nur sein kann, nicht unnötig melodramatisch, nicht unnötig angereichert mit Zufallswendungen oder deplatzierten Liebesgeschichten, stattdessen wird zwar nicht unbedingt nüchtern, aber unverblümt gezeigt, was mit so einer Revolution alles zusammenhängt, das Angenehme wie das Unangenehme, der Rausch nach einem erfolgreich gemeisterten Gefecht wie der Verlust eines Kameraden, der Rausch beim abendlichen Besäufnis in einer eroberten Stadt wie die Entbehrungen draußen in der Wüste, die Macho-Sprüche wie die nur mit Mühe unterdrückten Tränen oder Ängste. Dabei ist VÁMONOS CON PANCHO VILLA! ein Männerfilm im wahrsten Sinne des Wortes: Frauen tauchen eigentlich nur zu Beginn auf, danach verabschiedet sich der Film in einen Kosmos der Selbsterhaltung, der Befehle, des blutgetränkten Sandes. Ernst Jüngers Formel vom Kampf als innerem Erlebnis passt, glaube ich, auf den Prozess, den jeder unserer Löwen in der Folge durchläuft, wie die Faust aufs Auge: Wenn das Finale nur Tiburico lebend erreicht, dann liegt hinter ihm ein Weg, der rein in Kilometern genauso lang ist wie der, den er in seinem Innern hat zurücklegen müssen.
Auffällig ist – und eine Texttafel zu Beginn sagt das ganz deutlich -, dass VÁMONOS CON PANCHO VILLA! sich weitgehend eines rückblickenden Urteils über Gräuel und Glorie der Revolution enthält. Der Film ergreift keine Partei, feiert selbst Villa nicht über Gebühr, tut so, als wolle er einfach illustrieren, was Männern zu einem bestimmten Zeitpunkt in der mexikanischen Geschichte widerfahren ist, und wie sie damit umgegangen sind. Sicher, für einen kritisch-pazifistischen Blick bietet der Film noch immer genügend Widerhaken, an denen er sich verfangen kann, und wenn zu Schlachtengemälden in grimmigem Schwarzweiß eher muntere Folklore ertönt, oder wenn einer der Löwen bei einem sinnlosen Kneipenduell sein Leben lassen muss bzw. freiwillig aus Gründen der Ehre gibt, weil er bei einer Wette unterlegen ist, dann kann man darüber durchaus die Stirn in Falten ziehen, und sich fragen, was für ein Kriegerethos das ist, das nicht unterscheidet zwischen Tod auf dem Schlachtfeld und Tod vor dem Whiskeyfass. Für all die etwas plakativen komödiantischen Einlagen oder manche etwas, meiner Meinung nach, ausgewalzte Saufszene entschädigen aber die letzten fünf bis zehn Minuten, die wohl jeden irgendwie berühren, der einen Sinn für durch Bilder vermittelte Emotionen besitzt. Zu verstecken braucht VÁMONOS CON PANCHO VILLA! sich dort nämlich, finde ich, weder vor zeitgenössischen französischen Noir-Klassikern von Renoir oder Carné (mit denen Fuente eine ähnliche Ästhetik teilt) noch vor früheren Kriegsfilmen aus der Schmiede von Pabst oder Milestone (wenn auch bei Fuente das Verheizen von Menschenmaterial noch wesentlich stärker mit Sinn versehen daherkommt.) Dass mich dieser abschließende Teil der Revolutionstrilogie weitaus weniger berührt hat als die beiden Vorgänger, liegt wahrscheinlich daran, dass VÁMONOS CON PANCHO VILLA! vielleicht derjenige der drei Filme ist, den man noch am ehesten zu Zwecken der Glorifizierung und Romantisierung missbrauchen könnte, auch wenn Fuentes‘ Intention sicherlich eine ganz andere gewesen ist.
Wie anfangs erwähnt, keiner der drei Filme hat seinerzeit in Mexiko, was Kritikerlob oder Einspielergebnisse betrifft, großartig etwas reißen können, und im Falle von VÁMONOS CON PANCHO VILLA! sogar zum Bankrott der beteiligten Produktionsfirma geführt. Dennoch: Wie so viele zunächst verkannte Werke der Kinogeschichte sind alle drei Ausflüge, die Fuentes zwischen 1933 und 1936 in die unmittelbare Vergangenheit seines Heimatlandes unternimmt, wert, auch hierzulande breiter rezipiert werden, und für jeden hiermit nachdrücklich empfohlen, der einmal einen mexikanischen Film sehen möchte, bei dem es sich NICHT um einen des Horrors oder einen von Bunuel handelt.